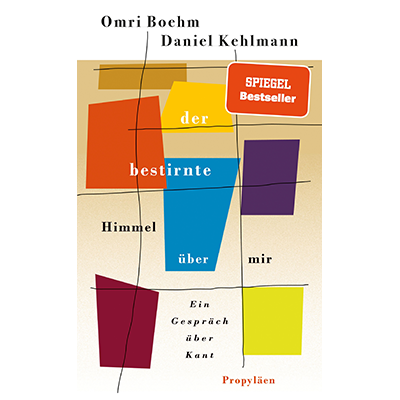Der Wille zur Hoffnung

Es gab sie trotz aller Widrigkeiten: Jüdinnen und Juden, die nach dem Überleben des Holocausts Filme machten, die das Grauen und seine Folgen darstellten. Diese Filme der unmittelbaren Nachkriegszeit geben einen so packenden wie bedrückenden Eindruck von den Traumata der Zeit nach 1945 – und von der Hoffnung, die dennoch nicht sterben wollte. Die mehrtägige Tagung „Von Transit und Trauma. Jüdische Erfahrung in der Nachkriegszeit im Film“, organisiert vom Zentralrat der Juden, ging in Wiesbaden diesen Erfahrungen nach.
Noch gibt es bei wenigen diese Erinnerungen: an das Grauen, das Elend, das Morden in den Arbeits- und Vernichtungslagern der Nazis. Aber mit dem Tod der letzten Zeitzeugen werden diese Erinnerungen verschwinden, nur Bilder werden bleiben und Texte von den Erinnerungen. In unserer stark visualisierten Welt werden die Bilder voraussichtlich immer wichtiger werden als letzte Zeugen dessen, was an Unsäglichem getan wurde und nie wieder passieren darf: der industriell betriebene Völkermord an den europäischen Juden. Das Menschheitsverbrechen mit etwa sechs Millionen Toten, der Zivilisationsbruch, wird mit all seinen Folgen auch in den kommenden Generationen nur in Erinnerung bleiben, wenn es dafür Bilder, auch bewegte Bilder gibt, Film eben. Welche Bilder aber werden dies sein? Und von wem stammen sie? Mit welcher Intention wurden sie gedreht?
Das sind einige der Grundfragen, die sich stellen, wenn man – wie Ende vergangener Woche bei einer Tagung der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Kooperation mit der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden – der jüdischen Erfahrung im Film der Nachkriegszeit nachgeht. „Von Transit und Trauma“ lautete der Titel der dreitägigen Veranstaltung, die einen Einblick gab in eine Welt, die film- und mentalitätsgeschichtlich außergewöhnlich war. Denn zu sehen waren vor allem Filme, die fast ausschließlich von Jüdinnen und Juden in den rund fünf Jahren unmittelbar nach dem Holocaust, also von 1945 bis 1950, gedreht wurden. Vor der Kamera, hinter der Kamera, auf dem Regiestuhl oder am Drehbuch saßen und standen Menschen, die entweder die Shoah überlebt hatten oder in ihrem Familien- und Freundeskreis Opfer des Massenmords zu beklagen hatten. Ohne oder mit nur geringer Übertreibung kann man von Filmen Traumatisierter sprechen, die Bilder und Worte für etwas suchten, was eigentlich nicht zu zeigen und kaum zu benennen war.
Alles zerstört
Dennoch gab es Menschen, die damals zur Kamera griffen – und zwar meist mit dem Impetus, dass man doch trotz aller Trauer aus dem Geschehen, aus all dem Mord und Tod lernen müsse, wenigstens das. Das waren ungemein mutige Unterfangen, denn die meisten Menschen waren keineswegs willig, diese Filme zu sehen, erst recht nicht die Deutschen, von denen nur eine kleine Minderheit bereit war, sich diesem deutschen Verbrechen und der eigenen Schuld zu stellen.
Hinzu kam das schlichte Chaos der Produktionsbedingungen in einem Kontinent, auf dem Schätzungen zufolge in diesen Jahren bis zu 60 Millionen Menschen ihr Zuhause verloren hatten. Sie wurden in der Regel „Displaced Persons“ (DPs) genannt. Nach den Beschlüssen der siegreichen Alliierten sollten in all dem Elend des versehrten Europas möglichst alle Menschen repatriiert werden, sofern das überhaupt möglich war. Gerade den jüdischen DPs aber war meist alles zerstört worden, Familie, Hab und Gut und Heimat. Sie kamen meist völlig entkräftet und traumatisiert direkt aus dem KZ, oft orientierungslos und mit nichts als dem, was sie am Leib trugen. Angesichts dieser Umstände kommt es einem halben Wunder gleich, dass es dennoch aus dieser Zeit Filme aus jüdischer Perspektive gibt.
Aber was zeichnet diese Filme, außer dem Überwinden widrigster Produktionsbedingungen, aus? Lassen sich in diesen Schwarz-Weiß-Filmen rote Fäden erkennen? Darüber lässt sich trefflich streiten, aber häufigere Ähnlichkeiten lassen sich schon diskutieren. Es gibt Randphänomene, die auffallen, etwa die häufige Mehrsprachigkeit der Filme (mit relativ wenigen Untertiteln), darunter oft Jiddisch. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler sind für unsere heutigen Sehgewohnheiten eher begrenzt in ihren Ausdrucksmöglichkeiten, mimisches Pathos in Stummfilmmanier ist nicht unüblich. Und manche Mimen sind schlicht schlecht, was natürlich auch am Geldmangel und den schwierigen Produktionsbedingungen gelegen haben mag. Eine pathetische Anfangsmusik war damals beliebt, gern in choraler Form wie in Bibelfilmen, auch wenn dies kaum unserem heutigen Geschmack entspricht. All diese Auffälligkeiten sind wohl auch dem damaligen Zeitgeschmack anzukreiden. Die UFA-Ästhetik war eben prägend, was übrigens ebenfalls die Männer-Frauen-Beziehungen angeht, die von so etwas wie Emanzipation noch weit, weit entfernt waren.
Irritierende Hoffnung
Wichtiger aber sind die inhaltlichen Parallelen, die sich zwischen den Filmen dieser Zeit und Prägung zu finden sind. Oft werden Suchbewegungen geschildert, was ja auch logisch ist, denn sich in dem europäischen Chaos der Nachkriegszeit in Zeiten von Papier, Schreibmaschine und Telefon (und weit entfernt von EDV und Internet) wiederzufinden, war bestenfalls ein Glücksfall, zumal völlig unklar war, ob die vermissten Liebsten überhaupt noch lebten. Das Suchen, in dem Fall der Mutter, schildert etwa der Film „Lang ist der Weg“ (Regie Herbert B. Fredersdorf, Marek Goldstein, 78 Min., DE 1947/48), wobei die in diesem Spielfilm eingeflochtenen Dokumentarszenen aus echten DP-Lagern mit damals Millionen von Insassen auch in Deutschland noch heute bewegen können.
Die Filme dieser Zeit mit der besonderen jüdischen Perspektive strahlen zudem eine manchmal fast irritierende Hoffnung aus – oder zumindest eine Art unbedingten Willen zur Hoffnung. Die meisten Filme wollen nach vorne schauen, auf die Zukunft, die oft in einer Auswanderung vor allem nach Israel/Palästina gesehen wurde. Einige Werke sind auch als klare Werbung für das zionistische Projekt zu verstehen, etwa der sehr eindrucksvolle Film „The Illegals“ (Regie Meyer Levin, 72 Min., Palästina/ USA 1947). Hier ist, wie in vielen Filmen dieser Zeit, das mühsame, oft illegale Grenzen-Überschreiten ein bestimmendes Element, und zwar Grenzen im wörtlichen, eher selten im übertragenen Sinne.
„The Illegals“ besticht vor allem durch die geradezu waghalsige Grundidee, die damals tatsächlich stattfindende Flucht (oder den Exodus) von Jüdinnen und Juden vor allem aus Polen über Italien und das Mittelmeer nach Palästina zu filmen – garniert durch nur zwei junge „professionelle“ Schauspieler, einen Juden und eine Jüdin, die ein Liebespaar spielen. Alle anderen Menschen in diesem Film spielen nicht, sondern sind tatsächlich auf der abenteuerlichen, ja gefährlichen Ausreise ins Heilige Land, weshalb der Film ein herausragendes Zeitdokument ist. Übrigens musste der Dreh für den Film recht plötzlich beendet werden, weil, wie auch zu sehen ist, das Ausreiseschiff nach Palästina von britischen Soldaten aufgebracht wird. Die Einreise von jüdischen Flüchtlingen ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina war verboten und die Gründung des Staates Israel noch ein Jahr entfernt.
Denkmal für die Opfer
Die auch in diesem Film hoffnungsvolle Orientierung ist bei erstaunlich vielen Filmen dieser Zeit verbunden mit dem Blick auf Kinder, die genau diese Hoffnung, diese Zukunft repräsentieren. Besonders eindrucksvoll gelingt dies dem Film „Die Gezeichneten“ (The Search) (Regie Fred Zinneman, 107 Min., USA/CH, 1948), ein Spielfilm, der das Schicksal von Kriegswaisen beleuchtet und tatsächlich mit vielen jüdischen Waisenkindern gedreht wurde. Die Traumata dieser Kinder werden schmerzhaft deutlich. Und dennoch spiegelt der Film auch die Hoffnung, dass sie überwunden werden können. Hier ist übrigens der ungemein gutaussehende und fein spielende junge Montgomery Clift zu sehen, dessen lange Szenen mit einem Waisenkind sehr anrührend sind, auch wenn seine pädagogischen Methoden nicht unbedingt denen des 21. Jahrhunderts entsprechen.
Am wichtigsten aber ist bei diesen Filmen sicherlich der sehr verständliche Drang vieler Filmemacher (männlich, denn zumindest dieses Genre war eine eindeutige Männerdomäne), den Opfern des Holocaust filmisch ein Denkmal zu setzen, ihrer und ihres Leids zu gedenken. Gepaart war diese Intention häufig mit dem Wunsch, dass aus all diesem Morden eine Hauptbotschaft gelernt werde, nämlich die der Völkerverständigung, des Friedens und der Versöhnung zwischen allen Menschen, um es im damaligen Duktus zu sagen. Das ging so weit, dass die Opfer in einigen dieser Filme offensichtlich wenig „jüdisch“ erscheinen sollten, um eine Identifikation mit ihnen und ihrem Leid in einer auch nach 1945 weiterhin oft antisemitisch gesonnenen Umwelt zu erleichtern.
Sehr radikal in diese Richtung geht der Film „Morituri“ (Regie Eugen York, 88 Min., Deutschland, 1948), unter abenteuerlichen Bedingungen produziert vom Holocaust-Überlebenden und späteren westdeutschen Filmmogul Artur („Atze“) Brauner. In diesem Film wie in einigen anderen dieses Hintergrunds treten jüdische Figuren auf, die den Deutschen in ihren Dialogen fast so etwas wie eine verbale Generalabsolution erteilen, nach dem Motto: Es waren ja vor allem die Verbrecher an der Staatsspitze, die einfachen Deutschen konnten irgendwie nicht wirklich etwas dafür. Das heute zu sehen, einerlei unter welchen Zwängen und mit welchen womöglich guten Intentionen Sätze dieser Art ins Drehbuch gewandert sind, ist oftmals peinlich und beschämend. Übrigens waren diese, sagen wir böse: Anbiederungsversuche an das deutsche, nicht-jüdische Publikum ziemlich vergeblich: Wie die meisten Filme dieser Art floppte „Morituri“ an der Kinokasse. Das deutsche Publikum wollte sich in seiner überwältigenden Mehrheit einfach nicht mit seiner Schuld auseinandersetzen – von gelegentlichen Protesten gegen diese Filme in und vor den Kinosälen ganz zu schweigen.
Leider aktuell
Etwas aus der Reihe fiel bei der Tagung eine Fernsehdokumentation aus den heutigen Tagen, „The Lost Film of Nuremberg“ (Regie Jean-Christophe Klotz, 52 Minuten, USA/ Frankreich, 2021) – aber sofort wurde klar, warum sie in diesem Rahmen so wichtig ist. Denn die Doku zeichnet die Jagd nach filmischen Beweisen nach, die die Hauptkriegsverbrecher im Nürnberger Prozess vom November 1945 bis zum Oktober 1946 überführen sollten. Die Brüder Budd und Stuart Schulberg, die aus einer Hollywood-Familie stammten, recherchierten im zerstörten Deutschland im US-Regierungsauftrag nach Filmaufnahmen, mit denen die Nazis selbst bis 1945 ihre Verbrecher in teuflischer Eitelkeit dokumentiert hatten. Sie wurden, ein damals revolutionär neues Verfahren, im Gerichtssaal als Beweismittel präsentiert und trugen so zur Verurteilung der NS-Verbrecher bei. Weil es Aufnahmen der Nazis selbst waren, konnte sogleich jeder mögliche Einwand entkräftet werden, dies seien manipulierte Aufnahmen. Das Schulberg-Unterfangen war umso spektakulärer, da die Suche nach dem Filmmaterial unter extremem Zeitdruck stattfand und weiter bestehende Undercover-Nazinetzwerke nach dem Krieg versuchten, die Filme über ihre Verbrechen, wie bei schriftlichen Akten, möglichst komplett zu vernichten. Zudem hat das filmische Material der Hollywood-Brüder unsere bildliche Erinnerung über die Nazis und ihre Verbrecher geprägt wie wohl kaum irgendeine andere visuelle Quelle.
Doch was war nun der beste Film, der auf der Tagung „Von Transit und Trauma“ zu sehen war? Dem Autor dieser Zeilen hat am besten der Spielfilm „Der Ruf“ (The Last Illusion) (Regie Josef von Báky, 104 Min., Deutschland, 1949) gefallen. Er beruht auf einem Drehbuch des österreichischen Regisseurs und Schauspielers Fritz Kortner, der auch die Hauptrolle übernahm. Der Film weist autobiografische Züge des Lebens Kortners auf, denn er erzählt, wie bei Kortner von der Rückkehr eines von den Nazis geflohenen Intellektuellen nach (West-)Deutschland. Das alles in der Hoffnung, so beim Wiederaufbau eines neuen, besseren Landes helfen zu können. Das Drehbuch ist clever, die Dialoge klug und oft witzig, die Bilder stimmig und gut geschnitten, die Darstellerinnen und Darsteller bis auf wenige Ausnahmen sehr gut. Das Resümee des Films aber ist bedrückend: Denn der Remigrant scheitert mit seiner sich selbst auferlegten Aufgabe, zumindest einer jungen Generation ein demokratisches, tolerantes und nicht-judenfeindliches Denken beizubringen. Kortners Figur stirbt sogar ob dieses Scheiterns in seiner kalten früheren Heimat.
Fast 75 Jahre nach dem Dreh von „Der Ruf“ wirkt der Film noch frisch – und leider aktuell. Denn der Antisemitismus ist in der deutschen Gesellschaft trotz des Holocausts, trotz all des staatlichen Gedenkens und einer intensiven, Jahrzehnte langen Beschäftigung mit dem Völkermord an den europäischen Juden in den Schulen und Universitäten nicht verschwunden. Im Gegenteil spricht vieles dafür, dass er wieder zunimmt, ja gewalttätiger wird. Immer wieder thematisierten Zuschauerinnen und Zuschauer im Wiesbadener Kinosaal die eigenen Erfahrungen oder die ihrer Familie mit Judenfeindlichkeit. Das ist deprimierend. Ebenso wie die Tatsache, dass die ganze Tagung von Anfang bis Ende unter Polizeischutz stattfinden musste.
Philipp Gessler
Philipp Gessler ist Redakteur der "zeitzeichen". Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Ökumene.