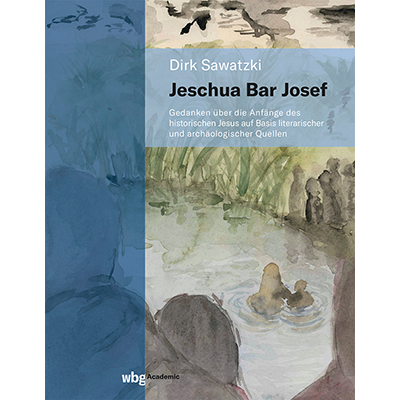„Ich bin da ganz ich“

Im Jahr 2014 sorgte ein Dokumentarfilm nicht nur kirchenintern für Aufsehen. Er porträtierte Vikarinnen und Vikare am Predigerseminar in Wittenberg. Der von der Kritik hoch gelobte Film „Pfarrer“, gedreht von ausgewiesenen Atheisten, zeigte seine Protagonisten, Pfarrerinnen und Pfarrern in der Ausbildung, als moderne Menschen, die oft am Glauben zweifeln – und trotzdem zu ihm stehen. Wie geht es den jungen Leuten heute, im Pfarramt? Was ist geblieben von ihren Zweifeln und ihrer Hoffnung?
Ein Film kann ein Leben verändern – und wer wüsste dies besser als Almut Bellmann und Chris Wright? Dabei sprach eigentlich nichts für die Wahrheit dieses etwas kitschigen Bekenntnisses unzähliger Filmnarren, als vor fünf Jahren zwei Berliner Dokumentarfilmer einer Frage nachgingen, die sie umtrieb: Was sind das eigentlich für verrückte Leute, die heute noch Pfarrerinnen und Pfarrer werden wollen? „Verrückt“ deshalb, weil die beiden Filmemacher aus der Hauptstadt ausdrücklich ihren Atheismus betonten, und das gleich am Anfang des Dokumentarfilms, den sie dann im Predigerseminar von Wittenberg drehten. Ihre Recherche in der Lutherstadt geriet zu so etwas wie einer Feldforschung in einem Milieu, das ihnen gänzlich fremd war.
Entstanden ist daraus der 90-minütige Film „Pfarrer“ (2014) von den vielfach ausgezeichneten Dokumentarfilmern Stefan Kolbe und Chris Wright. Er lief auf Arte, wiederholt wurde er als „Pfarrer werden“ im MDR, als DVD ist der Film noch zu haben. Die Rezensionen der Filmkritik zu diesem Dokumentarfilm waren in der Regel überaus wohlwollend – und in der evangelischen Kirche sorgt der Film immer wieder für Diskussionen. So sind also unsere angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer? So unsicher? So zweifelnd? So vorsichtig? So zaudernd?

Tatsächlich aber ist gerade dies das Faszinierende dieser Dokumentation, die ihren Protagonisten, Vikarinnen und Vikaren aus ostdeutschen Landeskirchen, auf Monate langen Kursen im Predigerseminar ungemein nahe kam. Immer wieder fragten die Filmemacher dabei aus dem Off in Variationen die gleiche Frage: Wie kannst du nur daran glauben? Willst du wirklich diesem Glauben dein Leben widmen? Bist du sicher? Und dass die Vikarinnen und Vikare eben nicht die 100-prozentig sicheren Streiterinnen und Streiter für die Sache Jesu und seine Kirche sind, macht den Film um so stärker. Aber wie denken die jungen Leute von damals heute über diese öffentliche Darlegung ihrer Zweifel und Schwächen? Haben sich ihre Hoffnungen, Zweifel und Ängste von damals in ihrem Alltag, heute im Pfarramt, bestätigt – oder sind sie verflogen?
Almut Bellmann sitzt in ihrem Pfarrbüro in Berlin-Mitte, mittenmang im Jewühl, wie man hier vielleicht sagen würde. Mit elf weiteren hauptamtlichen Mitarbeitern teilt sie sich die Arbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord. Dazu gehört die Gethsemanekirche, die am Ende der DDR ihre glorreiche Zeit hatte, als sie ein wichtiger Treffpunkt der Opposition gegen das SED-Regime war. Gerade in diesen Tagen ist diese Geschichte wieder sehr präsent.
Pfarrerin Bellmann, Jahrgang 1982, ist zu jung, um die Friedliche Revolution im ostdeutschen Staat vor 30 Jahren bewusst mitbekommen zu haben, auch ihre Eltern gehörten nicht zu den großen Oppositionellen. Dennoch hat sie etwas aus der familiären Erfahrung vor 1989/90 für heute mit genommen: „Durch meine Kindheit in einer christlichen Familie in der DDR habe ich gelernt, dass der Glaube nichts Selbstverständliches ist“, erzählt sie, „sondern hinterfragt wird. Bis zu der Frage: Was ist Wahrheit?“ Die Fragen nach der Wahrheit und nach Gott sind keine kleinen im weitgehend säkularisierten Berlin – und die Hauptstadt ist doch eine ziemlich andere Welt als die, aus der sie stammt: „Ich bin in einer sehr fröhlichen Gemeinde groß geworden. Die Kirche war mein Ort. Gottesdienste waren mir immer wichtig. Eines Tages wollte ich sie auch gern selbst gestalten.“
Keine Antwort
Das hat sie verwirklicht. „Es geht um die Liebe“, steht auf einer Postkarte an Almut Bellmanns Schreibtisch – und diese Karte gewinnt recht schnell eine besondere Bedeutung. Denn nach einer guten Viertelstunde des Gesprächs rückt die Pfarrerin mit einer überraschenden Pointe heraus: Mit dem gebürtigen Engländer Chris Wright, einem der beiden Filmemacher von „Pfarrer“, kam sie während der Dreharbeiten zusammen. Almut und Chris trennten sich von ihren Partnern für die neue Liebe – und leben nun schon seit Jahren mit den jeweils zwei Kindern zusammen, die sie in die neue Beziehung eingebracht haben. Das Ganze ist auch deshalb so spektakulär, weil es eine einzige Szene in der „Pfarrer“-Dokumentation gibt, in der die Filmemacher in das Geschehen eingreifen. Da wird Chris, das Mikro in der Hand, von den angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern vor der Kamera in eine Diskussion verwickelt, ob er nicht doch an so etwas wie Gott glauben könnte, auch wenn es den Vikarinnen und Vikaren sichtbar schwer fällt, genauer zu definieren, was das überhaupt bedeuten könnte. „Die Szene, als sich die Filmemacher in den Film einmischen, war interessant“, erzählt Pfarrerin Bellmann in ihrem Büro. „Da haben manche von uns gemerkt, dass wir auf so vieles keine Antwort haben, obwohl wir doch so viel gelernt hatten.“
Almut Bellmann hat in dem Film „Pfarrer“ von allen gezeigten Vikarinnen und Vikaren im Predigerseminar die beste Stimme – es ist ein Genuss, sie bei Gesangsübungen zu hören. Die Liturgie des Gottesdienstes ist ihr wichtig, das merkt man. Außerdem wirkt sie als eine vergleichsweise fromme Person im Kreis der anderen jungen Leute in Wittenberg. Ein Eindruck, den sie im Gespräch ein wenig relativiert, weil ihr offensichtlich das Wort „fromm“ nicht recht behagt: „Die evangelische Liturgie ist mir in Fleisch und Blut übergegangen“, sagt sie. Aber sie habe die Hoffnung, dass sie ihren Glauben auch immer wieder hinterfragen könne. „Deshalb würde ich mich nicht als fromm bezeichnen.“

Wie alle Protagonisten des Films – das fanden die Filmemacher offenbar besonders interessant – wird Almut Bellmann als eine tendenziell Zweifelnde gezeigt. Eine moderne Frau, der ihr Glaube nichts Sicheres ist, zumindest nicht immer. Diese Unsicherheit, dieses Sich-Selbst-Hinterfragen kam nicht überall gut an: „Ich wurde in manchen Internet-Foren für meinen im Film geäußerten Zweifel kritisiert“, erzählt sie, „und weil ich sage, dass Glaube viel mit Einüben zu tun hat.“ Irgendwelche „Kampfatheisten“ hätten dann gepostet: „Sie sagt es also selbst, dass Glaube nur Einüben ist. Aber das Einüben gehört nun einmal zur Religion dazu.“ Und sie fügt wie zur Erklärung hinzu: „Die Kirche braucht Zweifler. Es ist ein Missverständnis, zu glauben, dass der Glaube auf alle Fragen eine Antwort hat.“
Trotz der Offenheit, ja eines anklingenden Respekts für all die vielen Zweifler am Konzept Gott – Pfarrerin Bellmann scheint nach fünf Jahren als Pfarrerin ihren Ort gefunden zu haben, gerade in der „Welthauptstadt des Atheismus“, wie der US-Soziologe Peter L. Berger Berlin mal genannt hat. Diesen Beruf ergriffen zu haben, das sei die richtige Entscheidung gewesen, sagt sie. Es sei ein sehr vielseitiger Beruf. Man sei zusammen mit Menschen in besonderen Lebenssituationen, von der Geburt bis zum Tod. „Es ist verdichtete Zeit.“
Ein paar Kilometer entfernt dreht sich eine Freundin von Almut Bellmann, Ulrike Treu, Pfarrerin der Hoffnungskirche in Berlin-Pankow, auf dem Balkon ihrer Altbauwohnung eine Zigarette. Das wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn man nicht dank des Films wüsste, dass sie einmal sehr krank war, ja in gewisser Weise noch ist. In der Doku gibt eine eindrucksvolle Szene, in der Ulrike Treu die Filmemacher die Situation drehen lässt, wie sie sich eine Dosis Insulin in den Bauch injiziert. Dann deutet der Interviewer an, dass es ja noch schlimmere Krankheiten gebe als Diabetes, die sie mit zehn Jahren bekommen hat, Krebs etwa. „Bingo“, sagt Ulrike Treu lachend, „hatte ich auch schon.“ Mit 17/18 Jahren kam Krebs noch dazu. Die Schilddrüse war belastet, es gab schon Metastasen, eine Folgeerkrankung ihrer Zuckerkrankheit. Ulrike Treu zeigt die Narbe der notwendigen Krebs-Operation am Hals, kaum zu sehen, wenn man es nicht weiß. Und dann sagt sie den coolsten Spruch des Films: „Im Seniorenkreis kann ich total punkten, weil ich Diabetes habe und weil ich schon mal etwas mit Krebs hatte. Das ist total super, weil ich total authentisch bin.“ Für ihren Beruf sei dies die perfekte Krankheit, sagt sie mit einem herzhaften Lachen und einem Schuss Zynismus. „Ja, wirklich! Die können mir auch nichts vorjammern, weil ich weiß, was es heißt und was es nicht heißt.“

Pfarrerin Treu, als Tochter eines Pfarrers 1985 in Gotha geboren, ist mit immensem Charme und einer feinen Selbstironie gesegnet – kein Wunder, dass die Kamera der Filmemacher von „Pfarrer“ auf ihr kleben blieb. Da die beiden Filmleute etwa hundert Tage lang praktisch immer da waren und fast alles gedreht haben, fiel die Kamera nach Auskunft der früheren Vikarinnen und Vikare nach einer Weile in Wittenberg gar nicht mehr auf. Dadurch wirkt der Dokumentarfilm so nahe dran an den porträtierten jungen Menschen. Ulrike Treu findet sich jedenfalls gut getroffen: „Ich bin da ganz ich.“ Wie im Film ist ihre Ehrlichkeit auch im direkten Gespräch entwaffnend: „Ich kann nicht spielen, kann nur ich selbst sein.“
Über Narben sprechen
Es ist irritierend, dass die Dokumentation seinen mehr oder weniger gebrochenen Helden so nahe kommt, dass man glaubt, sie schon ganz gut zu kennen, wenn man ihnen persönlich zum ersten Mal begegnet – als könnte man gleich tiefer in das Gespräch einsteigen, weil man ja schon so vieles von ihnen weiß. Im Film wird auch in einer bezaubernden Szene gezeigt, wie Ulrike Treu versucht, mit ihrem Partner und ihrem Sohn per Skype zu kommunizieren – doch die Verbindung ist so schlecht, dass das nur mit großer Mühe klappt.
Mittlerweile hat sie zwei Kinder, aber die im Film gezeigte damalige Beziehung ist, wie bei Chris und Almut, ebenfalls zerbrochen. Das erzählt Ulrike Treu ungefragt, freimütig und recht bald im Gespräch. Diese Ehrlichkeit auch mit den unglücklichen Seiten der Biographie ist Teil von Ulrike Treus Selbstverständnis und ihrer Art von Seelsorge: „Ich will als Pfarrerin über Narben sprechen, nicht über Wunden.“
Drei Jahre hat Ulrike Treue nach ihrer Ordination in Halle/Saale in dem großen Plattenbau-Viertel Silberhöhe gearbeitet – eine Zeit, die sie als „schwer und reizvoll“ beschreibt, in einem Umfeld „absoluter Konfessionslosigkeit“, wie sie sagt. Mit Kindern sei sie einmal in ihrer Kirche gewesen und habe sie gefragt, wie denn dieses Gebäude heiße. Fast niemand habe darauf eine Antwort gehabt. Aber gerade die damaligen Gespräche mit den vielen, die so gar nichts vom christlichen Glauben wüssten, hätten ihr viel Spaß gemacht, eben über das Leben zu reden, über „die eigentlichen Fragen“. Denn: „Die lassen sich darauf ein.“ Und auch hier passt, was sie über ihre Krankheiten sagt: Jeder Mensch habe seinen Rucksack zu tragen, sie wolle da nichts verbergen, erklärt sie, es ist fast wie ihr Lebensmotto: „Man muss als Pfarrerin vom Leben erzählen können.“
Vom Leben kann auch Lars Schimpke erzählen, und wie! In der „Pfarrer“-Dokumentation ist er die vielleicht faszinierendste Gestalt, gerade weil ihm die Herzen nicht unbedingt gleich zufliegen. Schimpke sächselt mit solcher Hingabe, dass sich Nicht-Sachsen leicht die Zehennägel kräuseln, und seine Klamotten hat man so im Predigerseminar wahrscheinlich das letzte Mal in den Achtzigerjahren gesehen. Aber schnell wird klar: Schimpke ist ein Kämpfer. Zu beobachten ist ein junger Mann mit trockenem Humor und einer ganze eigenen Art von Frömmigkeit, jemand, der mit sich und seinem Glauben fast unerträglich hart ins Gericht geht, es genau wissen will, nichts verdrängt und nichts beschönigt.
Am Ende des Films wird sogar gezeigt, wie Lars Schimpke, offenbar nach einem depressiven Zusammenbruch oder ähnlichem, in der sächsischen Kommune Sehlis bei Leipzig ein altes Holzfenster repariert und gerade eine leicht eklige hellbraune Masse knetet. „Woran denkst du gerade, Lars?“, fragt ein Filmemacher aus dem Off. „Im Moment nur an Fensterkitt.“ Im Abspann des Films ist noch zu erfahren, dass er im Gegensatz zu allen anderen Protagonisten von „Pfarrer“ nicht ordiniert wurde. Was ist aus ihm geworden?
Mit einem feinen Lächeln holt uns Schimpke am Gleis des winzigen Bahnhofs von Wilkau-Haßlau bei Zwickau ab. Er wirkt entspannter als im Film, hat ein schickes blaues Hemd an und führt uns, immer wieder rechts und links grüßend, in seine schmucke Backsteinkirche, gebaut Ende des 19. Jahrhunderts. Nicht ohne Stolz führt Lars Schimpke durch den prachtvollen Bau, für den Fotografen zieht er seinen Talar an – mit der Ordination hat es nach kurzer Zeit dann doch noch geklappt, er steht ihm gut. Lars Schimpke, geboren 1978 im sächsischen Wurzen, teilt sich eine Stelle mit seiner Frau, die ebenfalls Pfarrerin ist. Er hat sie in einem Parallelkurs im Wittenberger Predigerseminar kennengelernt. Die Ausbildungsstätte in Sachsen-Anhalt erscheint als ein fast magischer Ort, er trennt und verbindet Menschen für ihr Leben.
Äußerlich könnte es bei Pfarrer Schimpke in seiner Lutherkirchgemeinde kaum besser laufen. Er konnte ein neues Gemeindezentrum einweihen. Immerhin noch rund 20 Prozent der Menschen in seiner Gegend sind Christinnen und Christen, was recht viel ist in Sachsen. Seine Gemeinde ist aktiv, auch er wirkt angekommen. Doch je länger man mit Schimpke redet, um so deutlicher wird, dass er auch hier zu kämpfen hat. Manches, was ihn in Wittenberg in die Depression gestürzt hatte, hole ihn hier wieder ein, sagt er: Werde man überhaupt auf die Zukunft des hiesigen Christentums vorbereitet, etwa auf die Zusammenlegung von Gemeinden? „Wenn man etwas größer zieht, wird es dünner“, sagt er – und an solchen Sätzen poppt ganz sanft das Maschinenbau-Studium auf, das er vor seinem Theologie-Studium bereits abgeschlossen hatte. Ehe so etwas wie seine Berufung kam. Schimpke nerven die Strukturdebatten in der Kirche, denn sie hielten ihn von dem ab, was ihn eigentlich beschäftige, nämlich ein stärkeres Engagement für „Friede, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung“, so sagt er es in einem Achtziger-Jahre-Duktus, „weil wir Kirche für andere sind“, Dietrich Bonhoeffer paraphrasierend. Es gebe zu viel „Selbstbespiegelung“ der Kirche. „Aber das ist nicht unser Auftrag.“
Die Bewegung „Fridays for Future“ etwa finde praktisch ohne die Kirche statt, sagt der junge sächsische Pfarrer. Einige hier in der Gegend seien „schon damit überfordert, dass wir nur Rad fahren“. Außerdem hätten seine Frau und er kein Auto und seien auch noch Vegetarier. „VW prägt hier die Mentalität“, erzählt Lars Schimpke, „Klimaleugnung ist hier fast Mainstream.“ Schimpkes Vorgänger hatte gehörige Probleme, weil er sich nicht klar gegen ein neues Pfarrerdienstrecht ausgesprochen hatte, das das Zusammenleben homosexueller Paare im Pfarrhaus erlaubte.
Ein Happy End
Und – apropos Widerstände – die rechte Szene in der Gegend, ist die stark? „Wir erleben hier nicht die extremen Formen“, sagt Pfarrer Schimpke, das gewaltbereite Milieu finde man eher in Zwickau, das allerdings gleich um die Ecke liegt. Die Gemeinde sei in Sachen Rechtspopulismus eher eine Filterblase, insofern da nicht viel ankomme. Gleichwohl gebe es bei manchen sehr konservativen Christenmenschen schon „fließende Übergänge“ zum Rechtspopulismus, meint Schimpke.
Es ist ein wenig seltsam. Trotz solch eher düsterer Analysen ahnt man: Sie werden Pfarrer Schimpke hier nicht unterkriegen. Und wahrscheinlich liegt das nicht zuletzt an seinem Humor, es ist einer der trockensten Sorte. Man kann viel lachen mit Lars Schimpke, wenn man genau aufpasst. Irgendwann bringt der engagierte sächsische Pfarrer uns wieder zum Bahnhof, der Zug fährt hier nur selten. Hier steht auch sein Elektrorad. Es war das erste in der Gegend.
Wieder in Berlin, endet die Geschichte so, wie ein Film am schönsten endet – mit einem Happy End. Chris und Almut stehen Hand in Hand in der Weddinger Osterkirche, sie sind gerade getraut worden. Ulrike Treu ist da, ebenso andere Gesichter, die man von der „Pfarrer“-Doku zu kennen glaubt. Die Berliner Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein hält den Gottesdienst auf Deutsch und Englisch, und sie macht das famos. „Es gibt den Film hinter dem Film“, sagt sie fast zu Beginn der Trauung – immer wieder gibt es von ihr und von den Hochzeitsgästen Anspielungen auf die Dreharbeiten, die Chris und Almut zusammen geführt haben. Der einst so leidenschaftliche Atheist Chris hat sich offenbar mit Almuts Glauben versöhnt. Aber nur sie sagt nach dem entscheidenden „Ja!“ noch „mit Gottes Hilfe“. Dann küssen sich die beiden. Und das Küssen will gar kein Ende nehmen.
Philipp Gessler
Philipp Gessler ist Redakteur der "zeitzeichen". Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Ökumene.