Der revolutionäre Millimeter
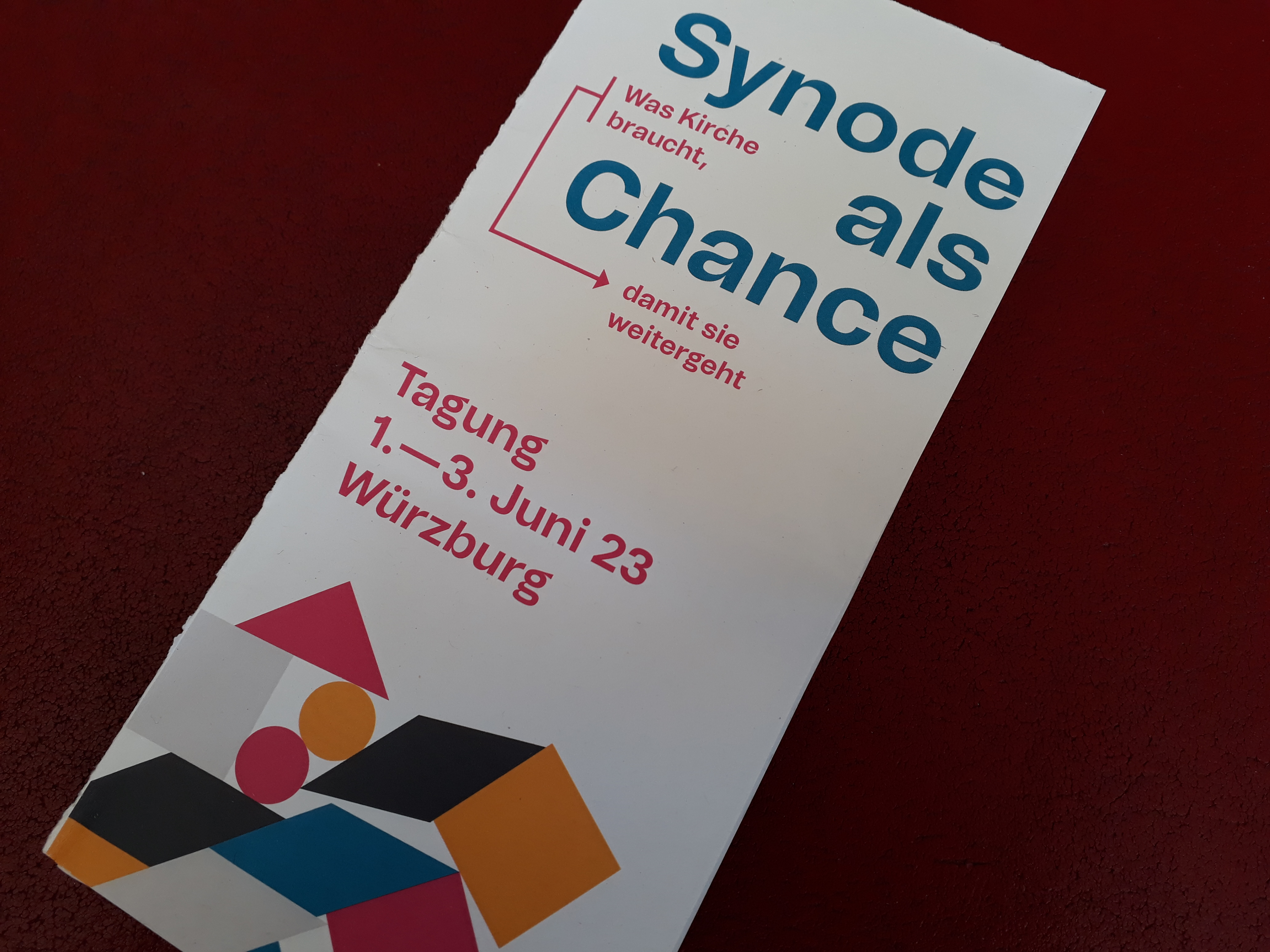
Auf einer Konferenz in Würzburg trafen sich viele der angesehensten Reformerinnen und Reformer in der katholischen Kirche, um den Synodalen Weg in Deutschland aufzuarbeiten. Sie wollten ermitteln, wie der angestoßene Reformprozess hierzulande und weltweit weiter voranschreiten könnte. Ein Klassentreffen der Unverzagten, die daran glauben: Die Kirche Roms wird nur durch mehr Demokratie, genauer: „Synodalität“ noch zu retten sein.
Es gab großartige Begriffe zu lernen: „Performanzen des Katholischen“, „affektive Kollegialität“, „Erinnerungs- und Erfahrungspakete“, „performativer Transformationsprozess“ … aber vor allem dieser: „der revolutionäre Millimeter“. Man ahnt, um was es gehen könnte, welche Spannung und leichte Ironie in dieser Wortkombination liegen. Zugleich aber war „der revolutionäre Millimeter“ eine gute Zusammenfassung dessen, was bis Samstagnachmittag rund 48 Stunden lang als Hoffnung bei einer hochkarätigen Tagung in Würzburg in der Luft lag: Könnte sich die katholische Kirche mindestens in Deutschland, wenn nicht gar weltweit doch ernsthaft reformieren, vielleicht „synodaler“, also de facto: demokratischer werden?
„Synode als Chance. Was Kirche braucht, damit sie weitergeht“ – das war der Titel der Konferenz in der Katholischen Akademie Domschule Würzburg. Organisiert wurde die Tagung von gleich vier renommierten Professorinnen und Professoren, Julia Knop (Universität Erfurt), Matthias Remenyi (Universität Würzburg), Matthias Sellmann (Universität Bochum) und Tine Stein (Universität Göttingen). Sie verbindet neben ihrer katholischen Taufe vor allem eines: Der Glaube, dass in dieser absolutistisch verfassten Kirche eben auch Laien (also Nicht-Priester), Frauen und vielleicht sogar Missbrauchsopfer irgendwann einmal mehr Macht erhalten oder zumindest Gehör finden könnten.
Kampf gegen die Kurie
Auf der Tagung versammelten sich etwa drei Dutzend vor allem akademisch hoch dekorierte Fachleute aus aller Welt, natürlich in erster Linie Theologinnen und Theologen, um dreierlei zu leisten: einen Rückblick auf katholische synodale Bemühungen in der Vergangenheit, eine Analyse des gerade mehr oder weniger beendeten Synodalen Weges in Deutschland und einen Ausblick auf die von Papst Franziskus selbst initiierten synodalen Dialog- und Reformprozesse weltweit. Ein ambitioniertes Programm, das wie am Schnürchen klappte, selbst per Video-Schalte über drei Kontinente hinweg, auch aus den USA und aus Lateinamerika wurden Expertinnen und Experten zugeschaltet. Dabei war auffällig, dass sich bis auf wenige Ausnahmen alle einig waren: Synodalität ist eine Chance für die Kirche – und wir müssen Papst und Bischöfe mehr oder weniger sanft dazu zwingen, die bisherigen Versprechen wahr zu machen, nämlich dass die Kirche ihr Gesicht zu mehr Gleichberechtigung und Mitbestimmung verändern muss. Man könnte auch sagen, im Heute ankommen muss.
Da viele in Deutschland oder im Ausland auf den jeweiligen Synodalen Wegen seit Jahren aktiv sind und man sich kennt, wurde auf der Konferenz in Würzburg viel geduzt und umarmt. Es hatte etwas von einem Klassentreffen, ein etwas nerdiges Rendezvous der kirchlich Engagierten, die noch die leisesten Andeutungen und Witzchen auf dem Podium und im Publikum zuverlässig verstanden. Brothers and sisters in arms, könnte man sagen. Im Kampf nämlich gegen eine katholische Hierarchie und Kurie, in der viele, wenn nicht die meisten Männer mit Bischofsmitra auf dem Kopf so gar nichts von Reformen halten (auch wenn sie öffentlich Gegenteiliges behaupten). Denn am Ende geht es um die Macht. Und trotz der guten Stimmung in Würzburg, war allen klar, dass der Katholizismus in Deutschland in einem tiefen Tal ist. Matthias Remenyi sagte wie viele: Die Krise der Kirche sei „manifest“. Und es sei die größte seit der Reformation vor 500 Jahren.
Historischer Ort
Zu diesem geschichtlichen Ausblick passte, dass das Treffen auf kirchengeschichtlich fast historischem Grund stattfand. Denn nur einen Steinwurf entfernt, im Dom zu Würzburg, tagte von 1971 bis 1975 die so genannte Würzburger Synode, in der sich die katholische Kirche Westdeutschlands schon einmal zu reformieren versuchte. Sie wollte die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) der Weltkirche „verdeutschen“, wie es damals hieß. Das sehr aufwändige Treffen mit illustren Teilnehmern wie dem großen Theologen Karl Rahner, dem langjährigen Bischofskonferenz-Vorsitzenden Karl Lehmann und dem späteren Papst Joseph Ratzinger endete jedoch enttäuschend: Viele Papiere scheiterten in der Synode am schwarzen Block der Bischöfe. Denn sie hatten ein Vetorecht bei allen Abstimmungen. Und was tatsächlich doch noch eine Mehrheit fand, wurde von Rom entweder abgelehnt oder noch nicht mal beantwortet. Das schlimmste Beispiel dafür ist das Votum oder vielmehr die Anregung der Würzburger Synode für die Weihe von Diakoninnen. Dieser Vorschlag verschimmelt seit fast einem halben Jahrhundert unbeantwortet in einem kurialen Schreibtisch in Rom. Das ist ein Affront. Und eine Demütigung.
Angesichts solchen Scheiterns war der Blick in die Vergangenheit am ersten Tagungstag nicht gerade ermutigend – wenn auch durchaus anregend. Bei einem Zeitzeugengespräch etwa ließ der 90-jährige Politik-Recke Bernhard Vogel, zur Synodenzeit in Würzburg der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) und später CDU-Ministerpräsident zuerst von Rheinland-Pfalz, später von Thüringen, pointensicher den Satz fallen: „Natürlich gab es ein Vetorecht der Bischöfe. Zurecht!“
Aus dieser damaligen Mutlosigkeit heraus ist es wenig erstaunlich, dass das Würzburger Treffen so ergebnisarm war, dass es fast nur noch Kirchengeschichts-Profis etwas sagt – anders als der zumindest teilweise aufmüpfige Katholikentag in Essen 1968. (Ein Transparent damals wurde berühmt: „sich beugen und zeugen“.) Vielleicht noch deutlicher vergessen ist das ostdeutsche Pendant zur Würzburger Synode, die „Pastoralsynode von Dresden“ (1973 – 1975). Aber immerhin stellte diese trotz Stasi-Verseuchung noch einen gewissen Empowerment-Schub und Demokratietrainingskurs für die Synodalen in der DDR dar. Manche sahen darin sogar tiefere Auswirkungen bis zur Friedlichen Revolution in Ostdeutschland 1989/90 gegründet. Außerdem waren die Erwartungen im SED-Staat für die Synode weitaus geringer als die in der fast zeitgleichen Kirchenversammlung in Würzburg. „Am Ende bin ich in ein tiefes Loch gefallen“, sagte die damalige westdeutsche Vorsitzende der Katholischen jungen Gemeinde (KjG), Elisabeth Rickal, nun eine ehrwürdige (und noch ziemlich zornige) alte Dame.
Schmerzhafte Erinnerung
Apropos Zorn: Der war am nächsten Tag der Konferenz immer wieder zu spüren. Denn der neue Synodale Weg (2019 – 2023) in Frankfurt am Main war ja ebenfalls nicht der durchschlagende Erfolg. Hier gab es laut Statut eine Ein-Drittel-Sperrminorität der Bischöfe, so dass selbst Papiere, die eine überwältigende Mehrheit im Synodenplenum erhielten, immer noch am schwarzen Block von Heute scheitern konnten. Das betraf etwa das so genannte Sexualpapier, in dem die Frankfurter Synode warme Worte der Anerkennung für LGBTQ-Menschen finden wollte. Im vergangenen Herbst war das Scheitern dieses Votums durch das bischöfliche Nein der große Eklat der Kirchenversammlung. Es gab Tränen im Synodenrund, von Traumata der queeren Synodalen nach so vielen Jahren des kirchlichen Engagements in einer tendenziell feindlichen Umgebung gar nicht zu reden.
Immer wieder wurde während der Würzburger Tage auch schmerzhaft daran erinnert, dass der Synodale Weg in Frankfurt am Main wegen der Verweigerungshaltung einer Minderheit unter den Bischöfen erneut die Diakoninnenweihe nur empfahl, also noch nicht einmal forderte. Das ist nicht anders zu verstehen denn als ein Zeichen eines fünfzigjährigen Stillstands, der in keiner Weise irgendwie als Erfolg oder gewagter Vorschlag der Deutschen zu verkaufen ist. Die Theologin Julia Knop, die eine entscheidende Stimme in Frankfurt gewesen war, sagte selbstkritisch mit zehn Wochen Abstand zur Synodalversammlung: Den dortigen Beschlüssen habe eindeutig die „Schlagkraft“ gefehlt.
Hinzu kamen aus Rom in den vergangenen Wochen rasch aufgestellte Stoppschilder, die die Frankfurter Beschlüsse gleich wieder zu kassieren versuchten, etwa die Laienpredigt bei Eucharistiefeiern, die öffentliche Segnung von homosexuellen Paaren und vor allem der geplante Synodale Rat. Der war in Frankfurt von der Synode beschlossen worden. Er soll aus Bischöfen und Laien bestehen und wirkliche gemeinsame Entscheidungen für die katholische Kirche in Deutschland treffen. Echte Beschlüsse! Gemeinsame Entscheidungen auch mit Laien! Verrückt!
In Angst erstarrt
Schon vor der letzten Synodalversammlung am Main waren alle deutschen Bischöfe im November letzten Jahres zu einem Routinebesuch („ad limina“) in Rom, eigentlich um den Synodalen Weg als Fortschritt und nötige Neuerung der Kirche zu verkaufen, so wollte es zumindest die klare Mehrheit der Oberhirten. Wie sie dort aber von den zuständigen Kurienkardinälen wie Schulbuben abgemeiert wurden, und zwar in einer Art Hörsaal wortwörtlich von oben herab, schockte und empörte selbst einige deutsche Bischöfe, die gar nicht klar zum Reformlager gehören. Manche Reformgegner in der deutschen Bischofsrunde sind ob des Widerstands in Rom gleichwohl bereits so in Angst erstarrt, dass sie seit wenigen Tagen sogar erwägen, den in Frankfurt beschlossenen Synodalen Ausschuss aus Laien und Bischöfen finanziell auszutrocknen. Der Synodale Ausschuss soll den einst viel mächtigeren Synodalen Rat vorbereiten.
Die Reformkräfte sind also mächtig unter Druck. Und der Ausgang des Ganzen ist ziemlich ungewiss. Im Herbst dieses Jahres wird es in Rom eine vom Papst einberufene Konferenz von Bischöfen und Laien geben, die erste Ergebnisse des weltweiten Synodalen Weges bewerten will. Im Herbst kommenden Jahres soll der globale Synodale Weg dann zu einem Abschluss kommen, wieder mit einer vatikanischen Konferenz am Tiber. Das ist dann kein Konzil, könnte aber doch für eine Reform der Kirche von Bedeutung sein.
So ist derzeit in der römisch-katholischen Kirche viel in Bewegung, und die Laien spielen, anders als etwa beim Zweiten Vatikanischen Konzil, sowohl auf deutscher wie auf internationaler Ebene mit, wenn auch nicht wirklich auf Augenhöhe mit den Bischöfen. Insofern hatte Gregor Maria Hoff, Professor für Fundamentaltheologie in Salzburg, auf der Würzburger Tagung natürlich nicht unrecht mit der Analyse: Der Synodale Weg habe trotz eher magerer Ergebnisse als Ereignis oder „Performance“ durchaus eine Wirkung in Sachen Synodalität. Denn hier vollziehe sich ja schon jetzt eine synodale Kirche.
Geist aus der Flasche
In Frankfurt wurde, so Hoff, trotz aller Fehler und Schwächen erprobt und war zu beobachten, wie eine synodale Kirche katholischer Färbung aussehen könnte – was übrigens im Großen und Ganzen nicht sehr viel anders daherkommt als die Synoden, die die EKD jährlich abhält. Hoff sagte folgerichtig: „Wir stehen nicht vor dem Umbruch, wir sind mittendrin.“ Der Geist ist aus der Flasche, könnte man sagen.
Dabei ist Synodalität vielleicht nicht der Königsweg, aber gibt es wirklich eine Alternative, wenn man das „Volk Gottes“ bei dringenden Fragen überhaupt hören will? Das fragte unter anderem Thomas Söding, Neutestamentler an der Universität Bochum und Vizepräsident sowohl des ZdK wie des Synodalen Weges. Im Hintergrund war auf der Tagung in Würzburg immer die Grabesstimme einer FORSA-Umfrage von Ende Januar zu hören. Gefragt wurde 4.000 Menschen in Deutschland nach ihrem Vertrauen in große Institutionen der Gesellschaft. Die katholische Kirche rangiert demnach mit acht Prozent (minus vier Prozent) auf dem drittletzten Platz. Dahinter stehen nur noch der Islam mit sechs Prozent und Werbeagenturen. Die evangelische Kirche hat bei dieser Frage immerhin noch 31 Prozent der Leute hinter sich. Was aber, fragte die als Gast eingeladene evangelische Theologin Ellen Ueberschär, hätten die Kirchen denn anderes in die Waagschale zu werfen als ihre Glaubwürdigkeit?Die Politikwissenschaftlerin Tine Stein wollte gleichwohl etwas Optimismus verbreiten. Ihre Rede vom „revolutionären Millimeter“, den der Synodale Weg eben doch darstelle, wurde zum geflügelten Wort auf der Konferenz in Würzburg. Zugleich brauche es aber auch den „begründeten Regelbruch“, um voran zu kommen. Stein warf dabei die Idee in den Raum, dass zwölf Bischöfe aus aller Welt zu Pfingsten 2025 berufene Frauen (wie Männer) zu Priester:innen weihen sollten, Rom hin oder her. Einen anderen Weg, nämlich den Kirchenaustritt, empfahl die Theologin Maria Mesrian, Mitgründerin der sehr rührigen katholischen Fraueninitiative „Maria 2.0“ und Vorstandsmitglied des jungen Vereins „Umsteuern! Robin Sisterhood“. Der steht unter anderem ausgetretenen Kirchenmitgliedern beiseite, wenn sie ihre nicht gezahlte Kirchensteuer nun anderen guten Zwecken zukommen lassen wollen.
Ach, diese Deutschen
Maria Mesrians Appell in die Würzburger Runde war ein Aufruf zu radikalerem Handeln: „Geht in den Dissenz! Ihr seid auf der richtigen Seite!“ Dem hielt unter anderem Ellen Ueberschär entgegen: Wer aus der Kirche austrete, verstärke am Ende nur die Radikalisierung innerhalb der Kirche, weil dann die Konservativen in ihr keine Gegenstimme mehr hätten. Denn auch das wurde auf der Tagung gerade am letzten Tag mit seinen internationalen Ausblicken deutlich: Weltweit gesehen, sind die Reformkräfte weder im Episkopat noch unter den Laien eindeutig in der Mehrheit. Die katholische Kirche in Deutschland ist, trotz aller Bremser und lauen Beschlüsse, immer noch ziemlich weit vorne, was auch den Widerstand des Vatikans gerade gegen die Vorschläge von nördlich der Alpen erklärt. Von der katholischen Kirche der Bundesrepublik ist man am Tiber mittlerweile offenbar ziemlich genervt: Ach, diese Deutschen!
Ein erstes Fazit der Konferenz zogen Johanna Beck und Johannes Norpoth. Sie waren mit immer wieder fest eingeplanten Zwischenrufen die offiziellen „Kongressbeobachter:innen“ der Tagung – und früher beide Opfer von Missbrauch in der Kirche. Es sei schon jetzt klar, dass Synodalität nie ein Tanz zwischen Bischöfen und Laien sein werde, sondern „ein hartes Ringen um den richtigen Weg“, wie Norpoth es ausdrückte. Johanna Beck ergänzte mit einem historischen Rückblick: Eine synodale Kirche müsse wie die Liturgische Bewegung vor dem Zweiten Vatikanum von unten kommen und einen langen Atem haben. Aber auch dann könne sie sehr viel verändern. Dazu brauche es Hoffnung, Mut und Kraft – und „die Heilige Geistkraft“. Fast kämpferisch schloss sich der Pastoraltheologe Matthias Sellmann diesem Votum an: „Der Geist von Frankfurt ist ungebrochen!“, rief er den Versammelten zu. Ob dieser Geist länger weht als sein älterer Bruder von der Würzbürger Synode vor fünfzig Jahren wird sich weisen. Auch gute Geister leben nicht ewig.
Philipp Gessler
Philipp Gessler ist Redakteur der "zeitzeichen". Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Ökumene.



