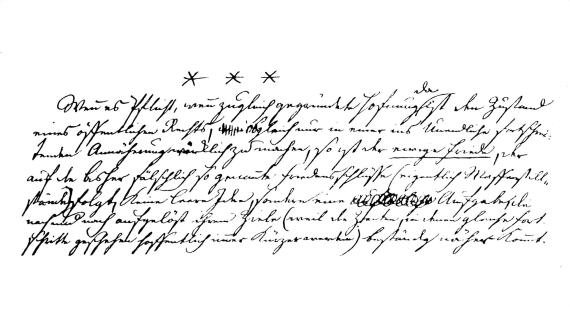Bei einem Treffen mit Ernst Ludwig Ehrlich (1921-2007), dem großen Denker des jüdisch-christlichen Dialogs, kam das Gespräch auf eine Argumentationsfigur, die gern benützt wird, um historische Personen vom Verdacht des Antijudaismus zu exkulpieren. Dabei wird als wahrscheinlicher Grund für ihre vermutete positive Haltung zum Judentum angeführt, es habe von zeitgenössischer jüdischer Seite keine Vorwürfe wegen Judenfeindschaft gegen jene gegeben. Ernst Ludwig Ehrlich, dem Humor wahrhaftig nicht fremd war, bemerkte dazu, Juden seiner Generation hätten solche Judenfeindschaft als so alltäglich angesehen, dass sie davon kein Aufhebens gemacht hätten. Nur der Umstand, dass man Christen getroffen habe, die sie nicht vertraten, sei zum Thema geworden.
Diese Bemerkung kann Christen daran erinnern, dass für viele Menschen aus dem Judentum die christliche Judenfeindschaft zu einem festen Bestandteil der kollektiven Erinnerung und bisweilen auch noch der eigenen Erfahrungswelt gehört. Damit ergibt sich eine Dissonanz, die auch in der Theorie und Praxis des Dialogs präsent ist, ohne dass sie stetig vergegenwärtigt wird. Während Christen sich bemühen, aus dem Schatten des jahrhundertealten Antijudaismus herauszutreten, und dankbar die Veränderungen in den Kirchen begrüßen, treffen sie bisweilen auf Juden, denen dennoch bei Anerkenntnis aller Bemühungen eine gewisse Skepsis bleibt. Bevor man in die Rolle der Kinder auf dem Markt verfällt und sich beschwert, dass Erwartungen nicht erfüllt werden (Lukas 7,32), ist es sinnvoller, die darin liegende Anfrage erst zu nehmen. Es geht letztlich darum, ob die Judenfeindschaft, die so lange zur Erscheinungsform der christlichen Kirchen gehörte, ihr nicht von der Wurzel her wesentlich eigen ist.
Und man soll sich nicht täuschen: Ein Blick in das Internet zeigt, dass auf nicht wenigen Seiten der sich religiös begründet gebende Antisemitismus immer noch lebendig ist, Menschen sich mithin darin gefallen, ihren behaupteten Glauben aus der Negation des Jüdischen herzuleiten. Und gerade hier wird auf die angebliche Tradition des Antijudaismus, den man so sakralisieren will, Bezug genommen. Es sind eben nicht nur Juden, die den Eindruck haben, dass auch ein besänftigtes Monster ein Monster bleibt.
Nun wird man schwerlich bestreiten können, dass ganze Epochen der christlichen Literatur voll von Belegen für Judenfeindschaft sind. Folgerichtig ist der Begriff Antijudaismus, der dafür in wissenschaftlichen Diskursen verwendet wird, eine Herleitung aus dem Ordnungssystem frühneuzeitlicher Bibliotheken: Hier wurden entsprechende Werke aufgelistet. Doch ist mit dem Befund selbst wenig ausgesagt über die theologischen Grundgedanken und die tatsächlichen Gegebenheiten, die den historischen Kontext bilden. Wenn Paulus im ersten Brief an die Thessalonicher schreibt, die Juden hätten Jesus getötet, so weiß er im Sinne der Faktizität wahrscheinlich darum, dass der Satz so nicht stimmt. Aber es geht ihm hier um eine theologische Aussage, nämlich um die, dass Leben und Tod Jesu als des von Gott Gesandten ausschließlich ein Geschehen in und mit Israel war. Diese Vorstellung, die offensichtlich auch Jesus teilte (Lukas 13, 33f), war keineswegs gegen „Juden“ gerichtet, sondern zielte auf eine christologische Aussage, mit deren Hilfe die Getauften in Thessaloniki ihre Situation deuten und ertragen sollten. Erst Theologen des 18. und 19. Jahrhunderts sahen darin Anzeichen eines Antisemitismus, was sie aber nicht kritisierten, sondern zustimmend notierten.
Die Heillosigkeit der Anderen
Die schon im Neuen Testament zu findenden Abgrenzungen gegenüber (anderen) Juden sind religionssoziologisch zunächst als Ausdruck einer sich im Prozess der Selbstdefinition befindenden Minderheit zu verstehen. Insbesondere weil man theologische Grundaussagen aufgrund der gemeinsamen biblischen Überlieferung teilte, wurde dadurch polemisch eine Schärfung der eigenen Position angestrebt. Durch diese Theorie der Selbstfindung durch Abgrenzung wurde freilich bleibend eine negative Konstante etabliert, und zwar eine Definition von kirchlicher Gemeinschaft, die primär oder partiell auf Abgrenzung beruhte. Nicht das Heil in der Kirche, sondern die angenommene Heillosigkeit außerhalb der Gruppe bestätigt die Eigenwahrnehmung und Selbstidentifikation. Dass man nicht zu jenen gehört, ist die eigentliche ekklesiologische Aussage, nicht aber eine positive Bestimmung der Zugehörigkeit. Und hier waren es insbesondere die Juden, die man immer wieder anführte, zumal man ihnen unterstellte, sie wüssten um die Wahrheit des Evangeliums.
Die Gebrauchbarkeit dieses Arguments ist eine Erklärungsmöglichkeit, aus welchen Gründen die Judenfeindschaft so lange alle Umstürze, Verwerfungen und Wandlungen im Lauf der Kirchengeschichte überlebte: Sie war nützlich, um innerkirchliche Probleme zu verdecken. Aber weder die Dauerhaftigkeit noch ihre Brauchbarkeit sichern ihr einen Wahrheitsanspruch zu. Sie gehört zu historisch bedingten Erscheinungen, die darin erklärbar, aber nicht nachvollziehbar sind und als Verfälschungen der Botschaft des Evangeliums zu gelten haben. Den theologischen Entwürfen der Judenfeindschaft vergangener Zeiten kommt so wenig eine Würde im Glauben zu wie den theologischen Begründungen zum Recht und zur Notwendigkeit der Sklaverei.
Freilich kann man die antijüdischen Texte einer Gegenlektüre unterziehen. Bis weit ins Mittelalter hinein verweisen sie auf eine Gegebenheit, die sie bekämpfen, nämlich ein bisweilen völlig unkompliziertes gemeinsames Leben von Juden und Christen, das auch religiöse Bereiche einschloss und darüber hinaus ein großes Interesse bei Christen an jüdischer Praxis und Gelehrsamkeit belegt. Die Vorstellung, Christen seien Juden immer schon feindlich begegnet, trifft wohl auf die Verfasser solcher Schriften zu, nicht aber auf die Mehrheit der Gläubigen. Anders wird man die unzähligen Gesetze und kirchlichen Verordnungen, die gemeinsame religiöse Feiern und sozialen Umgang verbieten, kaum deuten können. Sie zeichnen ein ganz anderes Bild als die judenfeindlichen Texte vermuten lassen.
Übrigens enthalten die Texte bisweilen auch Spuren theologischer Begründungen für eine solche Praxis der Konvivenz. Sie sind oftmals in dem Sinne heilsgeschichtlich akzentuiert, dass sie an der Berufung Israels festhalten, sie können mithin ein Heil ohne Ausschluss denken. Diese Positionen sind freilich in dem Maße, in dem Judenfeindschaft fast zu einem selbstverständlichen Habitus wurde - die völlige Erosion brachte die Große Pest im 14. Jahrhundert -, verdrängt und vergessen worden.
Dennoch ist es angebracht, sich ihrer namentlich im Rahmen einer neuen Israeltheologie zu erinnern. Zunächst einmal kann damit dem Entschuldigungsmythos begegnet werden, einzelne oder Gruppen hätten unreflektiert in einem System der Judenfeindschaft agiert, um so die Frage nach der Schuld zu erledigen. Es mutet geradezu bizarr an, wenn man etwa den Begründungen der Judenmörder während des Ersten Kreuzzugs folgt und über ihre religiöse Motivation spekuliert, während zeitgenössische Quellen sehr deutlich von Mordlust und Raubgier reden. Und als im Jahr 1555 Papst Paul IV. seine judenfeindliche Bulle erließ, tat er dies unter Aufhebung aller entgegenlautenden Texte seiner päpstlichen Vorgänger und brach völlig mit der kirchlichen Tradition.
Selbst wenn man konstatiert, dass die Stimmen, die sich gegen die Judenfeindschaft richteten, vereinzelte waren, so ist ihre Vergegenwärtigung notwendig, um die Vorstellung zu widerlegen, es habe gleichsam einen Zwang zur Judenfeindschaft gegeben. Es gab immer auch die andere Möglichkeit, was jedoch fast notwendig einschloss, sich von der triumphalistischen und antijüdischen Lesart der Bibel zu lösen.
Das Hören der verschütteten anderen Stimmen kann gegenwärtig dazu verhelfen, ein Christentum ohne Judenfeindschaft nicht als etwas ganz Neues wahrzunehmen, sondern als Besinnung auf Mögliches und Notwendiges. Dass dieser Prozess mit einer ständigen Selbstreflexion des Christlichen einhergehen muss, ist nicht fraglich.
Allerdings bedarf es dabei eines selbstbezogenen Perspektivwechsels. Denn während die verheerenden Folgen der christlichen Judenfeindschaft für die jüdischen Opfer bis zu den Verstrickungen in den Vernichtungsantisemitismus der Nazis nur noch von denen bestritten werden, die historische Belege aus welchen Gründen auch immer nicht anerkennen, ist die Frage, was denn die Judenfeindschaft dem Christentum angetan hat, wenig bedacht. Denn es geht bei der Überwindung der Judenfeindschaft keineswegs ausschließlich um ethische Fragen des Umgangs mit dem Judentum, sondern ebenso um das Innewerden dessen, was sie am Christlichen zerstört hat. Die Nichtbeachtung und das Beschweigen dieses Aspektes sind umso erstaunlicher, da die Judenfeindschaft auch den innersten Kern des christlichen Glaubens okkupiert hatte, nämlich den Glauben an den einen Gott, der die Gottlosen rechtfertigt.
Der Gott des Antijudaismus ist ein unberechenbarer und treuloser Gott, der seine gegebenen Verheißungen einfach transferiert. Es ist eine Verzerrung des biblischen Gottesbildes. So gesehen, ist es durchaus folgerichtig, wenn der vielleicht wichtigste Theologe der Spätantike, Origenes von Alexandrien, die Verstoßung Israels durch Gott im Bild der Ehescheidung deutet. Die erste Frau - Israel - wird verlassen, um die Ehe mit der neuen - der Kirche - einzugehen. Es sagt viel über diese Vorstellung aus, dass sie ohne jede Spur von Bedauern und Mitleid ist. Die eigene Unbarmherzigkeit wird auf Gott übertragen.
Dazu fügt sich dann auch der Verlust der Erfahrung der Dankbarkeit für das geschenkte Heil. Der Triumphalismus der Judenfeindschaft erzählt diese Geschichte in Worten des Besitzes, es geht um Enterbung und ums Erben, so als erhielte man, was einem zustünde. In Römer 11,34 zitiert Paulus den Propheten Jesaja: „Denn, wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen?“ Ein Blick in die Geschichte der Judenfeindschaft belegt, dass unzählige Theologen und Kirchenmänner meinten, sie könnten es in Bezug auf die Juden von sich behaupten.
Jedoch kontrastiert diese vor sich her getragene Gewissheit nicht nur damit, dass die Judenfeindschaft nicht irgendwann als erledigt angesehen wurde - wer immer sich mit der Geschichte der Judenfeindschaft im Christentum befasst, kann sich ab einem gewissen Zeitpunkt des Müdewerdens angesichts der Reproduzierung der immer gleichen Argumente, Tiraden und Polemiken wohl kaum erwehren -, sondern dass in ihnen das Motiv der Glaubensgefährdung von Christen durch Juden präsent ist.
Zweifelsohne handelt es sich dabei um eine Polemik, die in mittelalterlichen Schauermärchen mit schrecklichen Folgen für die Juden gipfelte und sehr früh gleichsam säkularisiert in den rassistischen Antisemitismus übertragen wurde. Aber es ist durchaus zu fragen, ob hier nicht doch ein ungewolltes Eingeständnis der eigentlichen Unzulänglichkeit vorliegt. So betrachtet, entbirgt die christliche Judenfeindschaft - was nebenbei ein Paradoxon sein sollte - im letzten eine tiefe Verunsicherung, einen Zweifel am Ja Gottes.
Arbeit und Geduld nötig
Die Judenfeindschaft ist eine Last, der man sich nicht einfach entledigen kann, und schon gar nicht unter apologetischen Vorzeichen. Sich aber von ihr zu befreien wird dann zur Notwendigkeit, wenn man die Zerstörungen bedenkt, die ihr außerhalb der Kirchen folgten, und zugleich wahrnimmt, welches Unheil sie über die gebracht hat, die dazu gehörten. Zweifelsohne ist das ein Prozess, der Arbeit, Anstrengung und Geduld erfordert. Aber bereits in diesem Prozess geschieht Befreiung, nicht zuletzt dadurch, dass die selbstisolierende Abgrenzung und Verteidigung dessen, was einem nicht gehört, weil es unverfügbar ist, durchbrochen wird.
Rainer Kampling