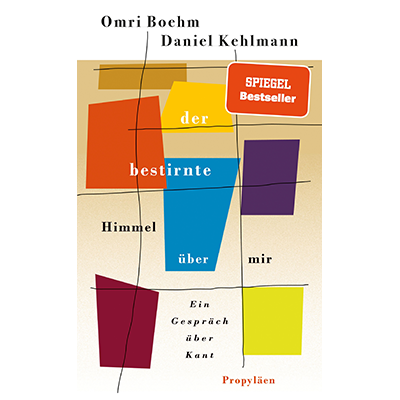Die Ohnmacht des Titanen

Es war ein schlichtes Begräbnis, das Gottfried Wilhelm Leibniz in Hannover zuteil wurde. Zwar war nicht nur sein Sekretär erschienen, wie manche wissen wollten, ein Geistlicher vollzog die Zeremonie, aber nur einer von den Hofräten war da, der hohe Adel oder gar erst der Kurfürst und König fehlten.
Letzterer freilich weilte in England. Kurfürst Georg I. Ludwig war seit zwei Jahren, seit 1714, als Georg I., König von England. Das Verhältnis zu seinem Vorzeigegelehrten aus Hannover war noch nie sehr intensiv gewesen. Mit Georgs Mutter Kurfürstin Sophie von der Pfalz hatte Leibniz dagegen einen regen geistigen Austausch gepflegt. Aber sie war nun schon zwei Jahre tot, sonst wäre sie auf Englands Thron gelangt. Aber Leibniz’ eigentliche und wahre Muse war deren Tochter gewesen, die Schwester des englischen Königs, Frau jenes brandenburgischen Kurfürsten, der sich 1701 selbst zum König in Preußen gemacht hatte: Sophie Charlotte, gebildet, voller Esprit und eine Schönheit zudem. Sie hatte leidenschaftlichen Anteil an Leibniz’ philosophischen Gedankengängen genommen, 1702 bis 1704 war er wiederholt in Schloss Lietzenburg (dem späteren Charlottenburg) gewesen, um mit ihr zu diskutieren. 1705 aber war sie gestorben, 36 Jahre alt. Es heißt, Leibniz habe sein nachmaliges philosophisches Hauptwerk, die Theodizee, aus Notizen zur Korrespondenz mit ihr komponiert.
Leibniz wurde am 14. November 1716 zu Grabe getragen. Geboren wurde er in Leipzig am 21. Juni 1646 nach julianischem Kalender, nach dem gregorianischen war es der 1. Juli. Erst im Jahre 1700 hatten sich die protestantischen Reichsstände der Kalenderreform des Papstes Gregor aus dem Jahre 1582 angeschlossen.
Ein schlichtes Begräbnis also, mit knapper Not statt eines unwürdigen. Ein Zeichen? Hatte sich der große Leibniz überlebt? In seiner Zeit war er unvergleichlich, ein Universalgelehrter, ein Titan unter den Wissenschaftlern. Als mathematisches Genie begründete er die Infinitesimalrechnung, mit der sich Differenzial- und Integralrechnung betreiben ließ, Schrecken mathematikschwacher Schüler bis auf den heutigen Tag. Seinerzeit allerdings gab es einen langen Streit darüber, ob nicht Newton die Priorität zukam, aus heutiger Sicht dagegen ein Nebenkapitel.
Was Leibniz sonst noch war und bestellte, war so vielfältig, dass es sich nur andeuten lässt. Als junger Diplomat wollte er den französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. dazu bewegen, nicht mit den Türken gemeinsam gegen Habsburg Krieg zu führen (vergeblich), als Bergwerksexperte verbesserte er windgetriebene Entwässerungsanlagen, er erfand eine Rechenmaschine und eine Chiffriermaschine (sie wurde nicht gebaut), er begründete oder wiederentdeckte das Dualsystem (Dyadik), auf der das heutige Computerwesen beruht. Und Leibniz bemühte sich in umfangreichen Korrespondenzen um die Versöhnung der Konfessionen (vergeblich). Verdienste über Verdienste. Aber großer Männer war man damals noch schneller überdrüssig als es heute angesichts des ständigen Gästebedarfs der Talkshows der Fall ist.
Monument im Strom
Und seine Philosophie? „Das metaphysische System von Leibniz“ sei, meint Wilhelm Windelband in seiner klassischen Philosophiegeschichte von 1891, dasjenige, „welches in der ganzen Geschichte der Philosophie von keinem an Allseitigkeit der Motive und an ausgleichender Kombinationskraft erreicht wird.“ Kein Wunder also, dass es weit über des Philosophen Lebenszeit hinaus wirkte und noch Kant anregte. Seine Philosophie stand wie ein Monument im mäandernden Strom der Frühaufklärung. Und doch will es heute scheinen, als sei sie schließlich doch ins große Meer des kollektiven Gedächtnisses (kaum vom kollektiven Vergessen zu unterscheiden) gespült worden, in dem heute nur noch Spezialisten ihr Vergnügen und ihr Auskommen erfischen.
Leibniz’ philosophisches Hauptwerk „Essais de Théodicée“ erschien 1710 anonym in Amsterdam, deutsch 1720: „Die Theodizee von der Güte Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Ursprung des Übels“. Leibniz schrieb seine Werke auf Latein oder Französisch. Das heute Befremdende seiner Philosophie liegt darin, dass sie ganz um eine theologische Frage kreist: Wie kann es sein, dass es so viel Unglück in Gottes Schöpfung, dieser unserer Welt, gibt? Zweifel daran, dass Gott der Schöpfer war oder gar solche an seiner Existenz, kamen, soweit wir wissen, Leibniz nicht. Aber wieso lässt der allgütige Gott das Übel in der Welt zu? Da er auch allwissend ist, kann es nicht aus Unkenntnis geschehen. Und da er allmächtig ist, sollte es ihm ein Leichtes sein, das Unglück aus der Welt zu schaffen. – Das Problem ist alt. Seine Formulierung wird Epikur (4./3. Jahrhundert vor Christus) zugeschrieben. Gelöst wurde es nicht.
Leibniz war Lutheraner und ein frommer Mann dazu. Anders als Luther war er der Meinung, dass Theologie und Philosophie nicht nur miteinander versöhnt werden können, sondern dass sie zwei Seiten einer Medaille sind. Die Vernunft war für ihn das göttliche Licht, wo es erstrahlt, könne es keine dunklen Munkel-ecken im Denken mehr geben. Was dem Menschen rätselhaft ist, werde sich bei rechtem Vernunftgebrauch klären lassen.
Luther war pessimistischer. Er hielt Theologie und Philosophie für nicht kompatibel, er wollte sie streng getrennt sehen. Das war ein Novum, denn die ganze Scholastik war im Grunde ein Ins-Verhältnis-Setzen der christlichen Theologie mit der antiken Philosophie. Zwar entsprang auch für den Reformator das Unglück in der Welt Gottes Ratschluss, aber der blieb letzten Endes unerforschlich: Über Gottes dunkle Seite (deus absconditus) sollen wir nicht nachgrübeln, uns sei aufgegeben, uns an den offenbarten Gott zu halten. Für Luther ging es um Gottes Rechtfertigung des Menschen, nicht um die Rechtfertigung Gottes durch den Menschen.
Nun, die Zeiten hatten sich geändert. Das Licht der Vernunft war dabei, aufzugehen. Leibniz war entschlossen, die leidige Frage nach dem Unglück in der Welt zu klären. Immerhin, dessen war er sich bewusst, er war ein großer Mathematiker und ein nicht minder großer Logiker. Logik und Mathematik aber galten ihm als die reinsten Instrumente der Vernunft. Er nannte seinen Untersuchungsgegenstand „Theodicee“, vom griechischen deos (Gott) und dike (Recht). Der Begriff machte schnell Furore.
Zunächst einmal stellte er fest, dass Gott eine Auswahl unter einer schier unendlichen Zahl von möglichen Welten gehabt hat. Für Gott gab es da keine Hindernisse. Oder doch? Über die Regeln von Mathematik und Logik konnte er sich nicht hinwegsetzen, oder doch nur, wenn er schon ganz am Anfang – als er sozusagen die Spielregeln für sein Schöpfungswerk festlegte – Ausnahmen eingetragen hatte. Doch als Gott die möglichen Welten musterte, fand er, dass die beste der möglichen Welt nicht ohne das Übel auskam. Dass aber Gott nicht anders konnte, als die beste der möglichen Welten ins Werk zu setzen, das stand für Leibniz fest. Seine, Leibniz’, Aufgabe bestand darin, diese Erkenntnis durch den Vernunftbeweis zu befördern. Hätten die Menschen genügend Einsicht, würden sie die Vollkommenheit von Gottes Schöpfung erkennen. Zwar hatte ihnen schon die Offenbarung auf die Sprünge geholfen, noch aber fehlte die vollständige Vernunfterkenntnis.
Ein Stolperstein für eine vom Übel freie Welt lag darin, dass Gott nach Leibniz dem Menschen Willensfreiheit zugestanden hatte (Luther war anderer Meinung, er hatte über diese Frage mit Erasmus erbittert gestritten). Damit war der Mensch für einen erklecklichen Anteil des Übels in der Welt verantwortlich (Luther hatte hierfür ja noch den Teufel). Aber für Leibniz war es keinesfalls ausgemacht, dass eine übelfreie Welt die beste sein würde, vielmehr lehre uns schon die Alltagserfahrung, dass es manchmal besser sein kann, Übel in Kauf zu nehmen, um Besseres zu erreichen. Es blieb dabei: Die Welt, die wir vorfinden, war die beste aller möglichen Welten.
Leibniz bewies, was er von vornherein zu beweisen sich vorgenommen hatte. Seine Theodizee ist gewissermaßen eine einzige große Tautologie. Aber was heißt das schon? In der Logik ist eine Tautologie eine Aussage, die aus logischen Gründen immer wahr ist. Für uns Heutige wären schon die theologischen Voraussetzungen, die für Leibniz feste Größen waren, Verhandlungsgegenstand.
Am klarsten und zugleich am rätselhaftesten hat Leibniz seine Philosophie in der späten „Monadologie“ dargestellt. Das Wesen der Dinge sei die Kraft, so muss man ihn verstehen, die Fähigkeit, etwas zu verändern. Diese aber muss auf eine kleinste Substanz zurückzuführen sein. Leibniz postuliert sie und nennt sie Monade. Die Welt besteht aus Monaden. Diese sind völlig voneinander abgeschlossen, sie sind metaphysisch undurchdringlich. Sie sind durchwegs Träger von „Empfindungen“. Es gibt die einfachen Monaden, aus denen etwa die Materie besteht. Sie haben nur unklare und verworrene Empfindungen (Perzeptionen). Die höheren Monaden, so die menschliche Seele, können sich mit ihren Empfindungen auf die Höhe klarer Vernunfterkenntnis aufschwingen (Apperzeptionen). Die höchste aller Monaden ist Gott. Wie aber kann die Welt funktionieren, wenn die Monaden fensterlos sind, sich also gar nicht beeinflussen können? Die Antwort: Sie wurden von Gott in „prästabilierter Harmonie“ präzise aufeinander abgestimmt. Jede Monade repräsentiert gleichermaßen die ganze Welt.
Das Übel aber hat Gott nicht von vornherein wegharmonisiert. Also, schlossen einige Leibniznachfolger, sei der Mensch am irdischen Unglück schuld, mittels des „metaphysischen Übels“, dessen theologischer Name Sünde war. Das Naturübel aber konnte man dem Menschen doch wohl nicht anhängen? (Notabene: Heute ist man sich da nicht so sicher)
Voltaires Spott
Jedenfalls verspottete Voltaire nach dem Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 Leibniz’ beste der möglichen Welten nach Strich und Faden, mit seiner Novelle „Candide ou l'optimisme“, 1759, deutsch 1776 unter dem Titel „Candide oder die beste aller Welten“. Irgendwie konnte es mit den Attributen Gottes nicht stimmen, irgendwie musste ihm die Fähigkeit oder der Wille fehlen, das Übel abzuschaffen, oder er hatte sich vielleicht längst zurückgezogen. Schritt für Schritt wurde der Gott der Deisten in Rente geschickt.
Dabei hätte es hinsichtlich der Rolle des Menschen in Gottes Vorsehung nahe gelegen, den Schluss zu ziehen, dass die Willensfreiheit des Menschen zwei Seiten hat: nicht nur die, die Übel schafft, sondern auch die Fähigkeit, die Welt zum Besseren zu verändern. Bei Leibniz war die Welt schon als eine dynamische angelegt, er hat es nur nicht mit genügend Nachdruck propagiert: durch den Fortschritt der Aufklärung erkennt der Mensch kraft seiner Vernunft nicht nur, dass Gott die Welt als die bestmögliche geschaffen hat, sondern dass dieses beste bereits ihre Perfektibilität beinhaltet, dass der Mensch nach dem Willen Gottes die Aufgabe hat, die Welt allmählich zur göttlichen Vollkommenheit fortzuentwickeln.
Es war Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), der diesen Gedanken in einer kleinen Schrift entwickelte: „Die Erziehung des Menschengeschlechts“ (1780), gewissermaßen eine Apologie des leibnizschen Gedankens: Das Alte und das Neue Testament waren Erziehungsbücher Gottes, mit der er der Entwicklung der Vernunft vorausgriff, bis der Mensch jene beiden hinter sich lassen kann. Merkwürdig bleibt, dass Lessing, anders als die vielen säkularen Menschheitsbeglücker, auch derer gedachte, die die vollständig aufgeklärte Welt nicht mehr erleben: Hier bringt er die „Hypothese“ einer Wiedergeburt des Menschen ins Spiel, man sieht: das Fortleben im Himmel war ihm schon zweifelhaft geworden.
Lessings Schrift war ein später Versuch, Glaube und aufklärerische Vernunft doch noch auf einen Nenner zu bringen. Doch auch er konnte Leibniz‘ Theodizee nicht retten. Immer rabiater setzte sich die Philosophie von der Theologie ab, von Kant bis hin zu Nietzsches Verdikt „Gott ist tot“, in welcher Formulierung bereits die Relativität allen menschlichen Wissens und Glaubens zum Ausdruck gebracht ist.
So ist Leibnizens Theodizee eher ein Schluss- als ein Meilenstein. Wenn mit ihr etwas bewiesen wurde, dann dies: Was der Strom der Zeit auseinanderreißt, zwingt auch ein Titan nicht zusammen.
Helmut Kremers
Helmut Kremers
war bis 2014 Chefredakteur der "Zeitzeichen". Er lebt in Düsseldorf. Weitere Informationen unter www.helmut-kremers.de .