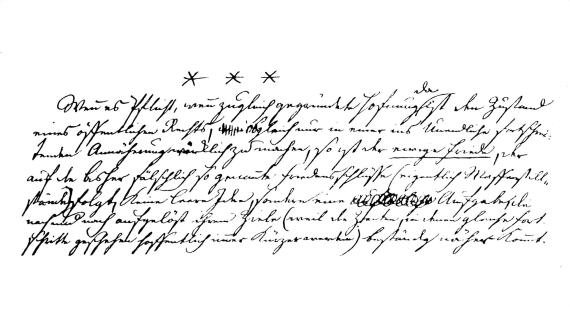Ein Ort religiöser Erfahrung

In einem Jahr voller Krisen waren die Bilder der Hilfsbereitschaft ein echter Lichtblick. Tausende Menschen, die sich ein Herz fassen und anpacken: Willkommensplakate am Münchner Hauptbahnhof, Kleider- und Spielzeugspenden, gemeinsames Kochen im Erstaufnahmelager, Fußballspielen, Gänge zum Amt, Ärzte, die unentgeltlich behandeln, Kirchenasyl bei drohender Abschiebung. Wäre die Sache, um die es geht, nicht so furchtbar ernst, man könnte im Rückblick fast von einem neuen Sommermärchen sprechen: Ein Land zeigt ein freundliches Gesicht – und die Kirchen sind mittendrin.
Überhaupt die Kirchen: Wann haben sie zuletzt in der Öffentlichkeit ein so positives Bild abgegeben? Normalerweise fallen die Reaktionen eher gespalten aus. Was die Kirche tut, ist den einen zu offen, den anderen zu festgefahren, mal zu einfach, mal zu abgehoben, hier zu kirchlich und da wieder nicht genug. Man kann es, auch innerkirchlich, schwerlich allen recht machen.
Hier aber ist davon keine Spur, zumindest wenn es um das Helfen selbst geht. Auch diejenigen, die mit Kirche nicht viel anfangen können, heißen ihr soziales Engagement gut. Und in der Kirche selbst? Die gelegentlichen Anflüge protestantischer Zerknirschtheit treten vorübergehend in den Hintergrund, die Dauerfragen nach der eigenen Rolle und Zukunft haben Pause. Man wird gebraucht, ist gefordert und muss sich dafür noch nicht einmal verbiegen. Wenn nicht alles täuscht, dann hat die Flüchtlingskrise für die Kirche – wenngleich unbeabsichtigt – einen durchaus belebenden Effekt. Mehr vielleicht, als manch intendiertes Reform- und Erneuerungsprogramm.
Gewiss, der öffentliche Wind hat in der Zwischenzeit ein wenig gedreht. Zu einem vollständigen Bild gehören auch das Erstarken der AfD, die Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte sowie erste Anzeichen von Erschöpfung unter den Helferinnen und Helfern. Es ist bei weitem nicht alles rosarot. Aber noch immer ist die Hilfsbereitschaft der Menschen bemerkenswert. Über 120 000 regelmäßige Ehrenamtliche zählt man allein unter dem Dach von evangelischen Initiativen. Darin sind diejenigen, die spenden oder sich eher sporadisch einbringen, noch gar nicht mitgerechnet. Und die Christen sind bei weitem nicht die einzigen. Das Engagement geht quer durch die Gesellschaft und entspringt ganz unterschiedlichen Motiven.
Belebender Effekt
Interessanterweise spielt dabei die Religiosität eine insgesamt nur untergeordnete Rolle. Nach allen Umfragen führen höchstens ein Fünftel der Flüchtlingshelfer unter den Gründen für ihren Einsatz auch die Religion an. Genauso wenig gibt es ein dezidiert nichtreligiöses Gegenprogramm. Das Helfen unterliegt heute gar keinem Programm, es bedarf keiner Theorie oder Weltanschauung. Es scheint für die meisten Menschen so selbstevident zu sein, dass es weder der Begründung bedürftig, noch ihrer wirklich fähig ist.
Seine Auslöser sind zumeist bildhaft und emotional. Man sieht, aus eigener Anschauung oder medial, das kaum fassbare Elend und hat das Gefühl, etwas tun zu müssen. Soll man es in Worte fassen, dann kommen Gründe wie die folgenden heraus: „Weil man das nicht einfach ignorieren kann“, „um etwas Sinnvolles zu tun“, „weil man gebraucht wird“, „weil es Freude macht“, „weil man so viel zurückbekommt“. Genau genommen begründen diese am häufigsten genannten Antworten das Helfen gar nicht wirklich. Sie drücken vielmehr seine kulturelle Selbstverständlichkeit aus.
Das Helfen, so könnte man aus der Vogelperspektive sagen, hat sich in den vergangenen 150 Jahren zunehmend säkularisiert. Es kommt heute weitgehend ohne den Deutungsrahmen des Christentums aus. Wie aber passt das zu der großen kirchlichen Resonanz? Ist man letztlich bloß Teil einer gesellschaftlichen Bewegung, ohne dass darin irgendeine religiöse Bedeutung liegt?
Einen interessanten Hinweis in dieser Frage konnte man schon 2012 einer Untersuchung des Diakonischen Werks der EKD entnehmen. Sie hatte erstmals flächendeckend die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie befragt. Und selbst hier landete der Glaube unter zehn möglichen Gründen für das Helfen abgeschlagen mit 27 Prozent auf dem sechsten Platz.
Dass bei solchen Studien alles auf die richtigen Fragen ankommt, zeigte sich dann einige Seiten weiter. Hier wurden die Ehrenamtlichen danach gefragt, wie wichtig Religiosität „bei der Ausübung ihrer Tätigkeit“ ist. Und auf einmal ergibt sich ein deutlich anderes Bild: Nur noch 24 Prozent antworten hierauf, dass Religion „gar keine Rolle“ spielt, während sie für 76 Prozent in unterschiedlichem Maße bedeutsam ist. Bedenkt man, dass unter den Befragten sogar 17 Prozent Konfessionslose sind, erhält dieser Befund zusätzliches Gewicht.
Die Religion ist also keineswegs aus dem Helfen verschwunden, auch nicht aus der Flüchtlingshilfe. Aber ihr Akzent hat sich deutlich verschoben: weg von vorgelagerten Begründungen und Motivationen, hin zur Tätigkeit selbst. In ihr scheint etwas vorzugehen, das die Helfenden auch in ihrem Glauben berührt. Diakonie, so könnte man theologisch formulieren, ist heute vornehmlich ein „Ort religiöser Erfahrung“.
Damit verschieben sich auch in der Diakonietheologie einige Akzente. Bis heute ist sie vielfach geprägt von der Gründerzeit der Inneren Mission im 19. Jahrhundert. Damals war die sozialistische Bewegung der große Gegenspieler, der die Arbeiterschaft zunehmend von der Kirche entfremdete. Ihrer religionskritischen Ideologie wollten Johann Hinrich Wichern und seine Weggefährten eine christliche Antwort auf die „Soziale Frage“ entgegensetzen. So verstanden sie das Helfen als eine eigene Form von Mission und beharrten darauf, dass allein dem christlichen Helfen die Kraft innewohnt, die sozialen Wunden der Zeit zu heilen. Überdies sollte eine solche „Liebestätigkeit“ auch nach innen zurückwirken: In der Hinwendung zu den Armen und Ausgeschlossenen erblickten sie die Quelle einer inneren Erneuerung der Kirche.
Will man heute noch konstruktiv an die erweckungsbewegten Gründerväter und -mütter der Diakonie anknüpfen, dann dürfte dieser letzte Aspekt am interessantesten sein. Denn offenbar liegt im diakonischen Handeln noch heute das Potenzial, das eigene Christsein in Bewegung zu versetzen. Im Übrigen aber ist das christliche Selbstverständnis, zumindest an der Basis, deutlich bescheidener geworden. Ihm ist das alte Abgrenzungsbedürfnis weitgehend abhandengekommen. In der Flüchtlingskrise – und nicht erst seitdem – wissen sich die Christinnen und Christen mit allen anderen verbunden, die sich denselben Zielen widmen. Ihnen gegenüber würde es geradezu seltsam klingen, auf der Notwendigkeit eines speziellen christlichen Auftrags zu beharren – von der prinzipiellen Überlegenheit des eigenen Helfens ganz zu schweigen.
Auf solche Ansprüche kann man getrost verzichten, wenn man den religiösen Glutkern von Diakonie in der ihr eigenen religiösen Erfahrungsdimension erblickt. Die Frage ist dann nicht nur, wie man etwas exklusiv Christliches nach außen trägt, sondern was mit dem eigenen Christsein geschieht, während man hilft.
„Religiöse Erfahrung“ meint dabei nicht Wunder oder Ekstasen. Es geht zunächst um etwas viel Alltäglicheres. Als religiöser Mensch setzt man seine Erfahrungen – positive und negative – unwillkürlich ins Verhältnis zu seinem Glauben. Manchmal erscheinen sie dadurch in einem anderen Licht; aber es gibt auch den umgekehrten Fall, dass die Erfahrungen den eigenen Glauben auf einschneidende Weise verändern. Und schon Martin Luther wusste, dass ein Glaube, der sich vom Strom der eigenen Lebenserfahrung abschneidet, mit der Zeit schal wird.
Betrachtet man die Sache wissenschaftlich, dann besteht eine religiöse Erfahrung aus mindestens drei Elementen: aus einem Widerfahrnis, seiner jeweiligen Deutung und schließlich dessen Artikulation. Im gelebten Leben aber sind die drei so innig miteinander verwoben, dass wir sie zumeist als ein und dieselbe Erfahrung erleben. Darüber hinaus kann im Christentum prinzipiell alles zur religiösen Erfahrung werden, da es die Welt nicht in heilig und profan aufteilt. Aber es gibt doch bestimmte Dinge, Orte oder Tätigkeiten, die dem offensichtlich mehr entgegenkommen als andere. Das Meer, die Liturgie, die Kunst, die Bibel – und in besonderer Weise die Begegnung mit dem Leben eines anderen Menschen.
Genau dies kann sich beim Helfen auf ganz eigene Art ereignen. So anstrengend und erschütternd es bisweilen ist, für viele Menschen liegt darin doch ein Empfinden von Sinn und Lebendigkeit, das die Mühen auf eine schwer zu beschreibende Weise aufwiegt. Auf sehr individuelle Weise prägt und verändert es, wenn man sich auf die Erfahrungen einlässt, die sich beim Helfen einstellen. Und das dürfte für einen Christenmenschen allzumal gelten.
Die Erfahrungen des Helfens drängen zur Religion, wie das Christentum dazu drängt, im helfenden Handeln Erfahrung zu werden. Aufs Ganze gesehen kann sich das Christentum nicht von dieser Erfahrungsdimension abschneiden, ohne selbst Schaden zu nehmen. Denn was man im Gottesdienst hört, singt und betet, das gewinnt an Sinn und Bedeutung, wenn es in den Erfahrungshorizont des Diakonischen einrückt.
Helfen als Gottesbegegnung
Um nicht missverstanden zu werden: Das Helfen hat viele Aspekte und der religiöse ist heutzutage nur einer von ihnen. Man kann das Helfen in moralischer Hinsicht betrachten und wird viele gute – auch christliche – Gründe dafür finden. Man kann es unter sozialpädagogischem Aspekt betrachten und überlegen, auf welche Weise man handeln soll. Und man kann fragen, was einen in all dem religiös bewegt. Wenn die bisherigen Überlegungen stimmen, dann könnte man es vielleicht so sagen: Während man beim Helfen aus verschiedenen Gründen und auf verschiedene Weisen ein Gebender ist, wird man in religiöser Hinsicht gerade zum Empfangenden.
Lange Zeit stand die theologische Beschäftigung mit der Diakonie im Bann der so genannten Propriumsfrage: Was haben wir zu geben, was andere nicht haben? Was können wir besser? Was unterscheidet das christliche Helfen von dem anderer Menschen? Es mag darauf eine Antwort geben oder auch nicht. Mir scheint, die theologisch interessanten Fragen beginnen heute jenseits des Propriums: Warum und wofür braucht das Christentum die Diakonie? Inwiefern ist sie eigenständiger und unverzichtbarer Teil unserer Religion?
Ein Strang der christlichen Tradition hätte darauf wohl geantwortet, dass im Helfen die Möglichkeit einer besonderen Gottesbegegnung verborgen liegt. Wer den Hungrigen sein Brot bricht und den Durstigen zu trinken gibt, wer seine Kleider mit den Armen teilt und die Gebrechlichen bei sich aufnimmt, der nimmt nach dem Matthäusevangelium Christus selbst bei sich auf.
Tobias Braune-Krickau