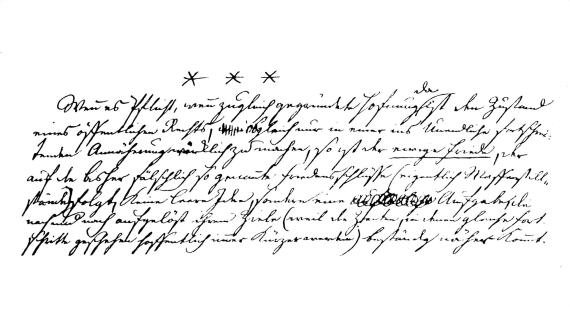Unübersichtliche Landschaft

Regelmäßig treffe ich beim Einkaufen eine afrikanische Frau. Ich nehme an, dass sie in der Nachbarschaft wohnt. Eines Tages kommen wir zufällig ins Gespräch, reden über das Wetter und die Kinder und stellen uns gegenseitig vor. Am Ende fragt Martha mich: Where do you worship? "In welcher Kirche besuchen Sie den Gottesdienst?"
Die Frage verdattert mich. Wie kommt sie darauf, dass ich zur Kirche gehöre? Steht mir ins Gesicht geschrieben, dass ich "Berufschristin" bin? Und will sie mich in ihre Gemeinde mitnehmen? Bin ich zum Missionsobjekt geworden? Etwas verlegen nenne ich die Kirche, in die wir ab und zu zum Sonntagsgottesdienst gehen und verabschiede mich. Diese Begegnung liegt schon mehrere Jahre zurück, aber sie geht mir nicht aus dem Sinn.
Eine Debatte mit jungen Theologinnen und Theologen aus Afrika und Asien ist mir ebenso im Gedächtnis geblieben: Es ging um das Thema Homosexualität. Dass wir uns in diesem Punkt nicht einig sein würden, war von vornherein klar, aber wir wollten wenigstens aufeinander hören und die Argumente und Gefühle der anderen verstehen. Die Offenheit auf beiden Seiten war beeindruckend. Dennoch wurde die Debatte sehr hitzig und gipfelte unter anderem in der Feststellung eines ghanaischen Pastors: "Vor zweihundert Jahren seid ihr nach Ghana gekommen und habt meinen Vorfahren verboten, mehrere Frauen zu haben. Heute kommt ihr und schreibt uns vor, Homosexualität normal zu finden."
Am Sonntag Reminiszere bin ich eingeladen, in der indonesisch-lutherischen Kirche zu predigen. Vor dem Gottesdienst spricht mich ein älterer Herr an: "Bitte denken Sie in diesem Gottesdienst auch an die verfolgten Christen in unserer Heimat!" Eindrücklich erzählt er von brennenden Kirchen, von Christen, die mit Steinen beworfen werden, und von Lärmbelästigungen, die jede Art von Gottesdienst verunmöglichen. Ich nehme das Anliegen in die Fürbitten auf. Als ich einige Zeit später Vertreter der Gemeinde zu einer Begegnung mit indonesischen Muslimen einladen will, erhalte ich eine schroffe Absage: "Wir sind in unserem Kirchenvorstand zu dem Ergebnis gekommen, dieses Angebot der Gegenüberstellung mit indonesischen Muslimen abzulehnen."
Die beschriebenen Szenen zeigen, dass Migrantengemeinden oder Gemeinden anderer Sprache und Herkunft in deutschen Großstädten dazugehören. Ja, man kann davon ausgehen, dass dort an einem Sonntagnachmittag inzwischen ebenso viele Gläubige in eine dieser Gemeinden gehen, wie am Sonntagvormittag in einen "normalen" evangelischen Gottesdienst. Manche versammeln sich in angemieteten Räumen, andere können es sich leisten, eine Kirche zu mieten, manche sind in Bürogebäuden untergekommen, andere können eine eigene Immobilie erwerben und manche sogar eine Kirche kaufen. Presbyterianer aus Ghana, Methodisten aus Korea, freie Evangelische aus China, Lutheraner aus Indonesien, Baptisten aus Myanmar, Pfingstler aus Nigeria, Katholiken aus Vietnam feiern in deutschen Großstädten Gottesdienst, jeder für sich, selten auf Deutsch, oft auf Englisch oder auch in der Landes- oder Regionalsprache der Gemeindemitglieder. Auch wenn der Anspruch vieler dieser Gemeinden lautet: We will reach out to the Germans, "wir wollen auch die Deutsche erreichen", gesellen sich von denen nur wenige zu ihnen. Reverse mission, "umgekehrte Mission" ist der Plan, der vermeintlich gottvergessenen neuen Heimat den Glauben zurückzubringen. Dass dies irgendwie nicht funktioniert, sehen inzwischen einige ein. Doch ihr Wunsch ist, mit uns gemeinsam Christsein zu gestalten.
Und es entwickeln sich tatsächlich immer mehr Beziehungen zwischen den ungleichen Gemeinden. Manche der neuen Christen nehmen davon Abstand, alle Deutschen für ungläubig zu halten, und manche deutsche Gemeinden entdecken inzwischen, dass die Afrikaner, Lateinamerikaner und Asiaten mehr sind, als laute Gäste in ihren Räumen. Eine interkulturelle Öffnung der Gemeinden von Migranten und Einheimischen gewinnt an einigen Stellen an Kontur. So hat in Hamburg eine afrikanische Gemeinde inzwischen offiziell um Aufnahme in die Landeskirche gebeten. Eine Gemeinde in Lübeck, der sich vor allem Iraner und Iranerinnen angeschlossen haben, hat inzwischen ein interkulturelles Gemeindekonzept entwickelt. Und die Missionsakademie an der Universität Hamburg bietet eine theologische Langzeitfortbildung für Prädikanten, Studierende, Pfarrer und Pfarrerinnen sowohl von Migranten- als auch von einheimischen Gemeinden an, bei der die interkulturelle Öffnung im Zentrum steht.
Übrigens sind viele freikirchliche Gemeinden viel beweglicher als die volkskirchlichen. Sie nehmen das Evangelium als Anleitung zu Gastfreundschaft und Willkommenskultur ernst und sind längst zu internationalen Gemeinden geworden. Sie beten unbefangen auch in anderen Sprachen, freuen sich an der Musik aus anderen Kulturen und stehen Wundern und Zeichen offen gegenüber. Freikirchen und Pfingstgemeinden wachsen in Deutschland, weil Menschen aus aller Welt sich ihnen anschließen. Auch wenn sich die Zahl der Mitglieder in Grenzen halten, ist diese Entwicklung doch eine dringende Mahnung an die Großkirchen, zu zeigen, was an überzeugendem Christentum in ihnen steckt und warum es für Christen aus anderen Kulturen eine Option sein könnte, sich ihnen anzuschließen.
Letztlich wird die Zukunft der Kirche in Deutschland sich danach richten, ob der Zwischenraum, den die Migrantengemeinden eröffnet haben, als Chance genutzt wird und eine Brücke entsteht zwischen Volks- und Freikirche, so dass aus dem Nebeneinander der Kirchen in der Zukunft eine ökumenische Gemeinschaft wird.
Und will man den Blick über Deutschland hinaus wagen, dann gilt festzuhalten: Noch gehört weltweit rund die Hälfte der zwei Milliarden Christen der römisch-katholischen Kirche an. Ein Viertel verteilt sich auf die anderen klassischen Konfessionen und ein weiteres auf unabhängige und pfingstliche Bewegungen und Kirchen. Und Letztere wachsen rasant und verändern das Gesicht der Weltchristenheit (siehe Seite 24).
Beispiele und Gegenbeispiele
Dabei bieten diese Gemeinden und Kirchen, denen rund 500 Millionen angehören dürften, ein unübersehbares Panorama. Die Vermutung, dass sie tendenziell biblizistisch, moralisch konservativ und intolerant sind, würde sofort die Auflistung der Gegenbeispiele nach sich ziehen. Die Behauptung, dass diese Kirchen eher fromm als karitativ sind, widerlegt der Blick auf unzählige kleine und große Hilfsorganisationen, die mit ihnen verbunden sind. Und würde man sie als kulturlos und ihre Botschaft als apokalyptisch beschreiben, könnte jemand darauf hinweisen, dass diese Gemeinden oft alte Kirchengebäude erwerben, Kunst fördern und sich gesellschaftlich und politisch vielfältig engagieren.
Ein Blick auf die übrigen, klassischen Kirchen, mainline churches, zeigt, dass sie ihrerseits zu einer Charismatisierung neigen, die mitunter individualistische und konservative Züge des Glaubens fördert, bis hin zu fundamentalistischen Abgrenzungstendenzen. In riesigen Arenen, wie im Heiligtum der Mutter Gottes in Sao Paulo das 100.000 Menschen fasst, versucht der katholische Priester Marcelo Rossi mit charismatischen Gottesdiensten, den Pfingstkirchen, die viele Katholiken anziehen, etwas entgegenzusetzen.
Südkorea ist das Land, das die meisten Missionare entsendet, um weltweit die Ausbreitung des Christentums voranzutreiben. Auch presbyterianische Kirchen schicken Missionare in die Länder Asiens, aber ebenfalls nach Afrika und Europa. "Südkoreas Christen nehmen ihren Glauben so ernst, wie man es in Europa zuletzt im 19. Jahrhundert erlebt hat", hat ein koreanischer Politologe festgestellt.
Das Versprechen, der wahre Glaube an Gott bringe Erfolg, Wohlstand und Heilung, ist längst nicht mehr nur in den pfingstlichen und unabhängigen Kirchen Afrikas zu hören, sondern auch in klassischen protestantischen Kirchen. Die konfessionelle Landschaft ist unübersichtlich geworden. Und immer weniger dürften Menschen in Zukunft ein Leben lang der Kirche angehören, in der sie getauft wurden. Die Biografien von Kirchenmitgliedern in Afrika, Asien und Lateinamerika zeigen ein munteres churchhopping, Übertritte von der einen zur anderen Kirche, wie sie bislang in den USA zu beobachten sind.
Wie also wird sich das Christentum weltweit entwickeln? Noch mag man in Deutschland die Expansionsträume von charismatischen Gemeinden und Freikirchen belächeln. Aber eine Theologie, die sozialethische Themen ins Zentrum stellt, die Frieden und Gerechtigkeit für den Kern der christlichen Botschaft hält, ist nicht en vogue. Eine Theologie, die Gott in der Wüste begegnen will, der das Kreuz eine Weisheit ist und die Jesus im Angesicht des leidenden Nächsten erkennt, für die der Glaube an allererster Stelle die Gebrochenheit der Existenz angemessen in Worte fasst, ist keine leichte Kost. Christen, die im Namen Gottes gegen die Erderwärmung und für einen maßvollen Lebensstil aller demonstrieren und sich von Gott in den Widerstand gegen die Mächtigen und Herrschenden der Welt gerufen wissen, sind nicht so attraktiv, wie erweckte und inspirierte Massen. Diejenigen, die auch Gottes Schweigen und seine Abwesenheit als Teil ihres Glaubens begreifen, werden als unbequem und unglaubwürdig empfunden. Diejenigen, die ihren Glauben daran ausrichten und sich um diese Botschaft sammeln, dürften immer mehr zur Minderheit werden.
Oder waren sie es schon immer? Denn wären sie viele gewesen, hätte sich die Welt dann nicht anders entwickeln müssen? Können interkulturelle Gemeinden diese Theologie der leisen und gebrochenen Töne neu beleben auf dem Hintergrund der Erfahrungen, die viele Migrantinnen und Migranten mitbringen? Die neuen Gemeinden bringen eine große Hoffnung auf Gottes Wirken im Geist mit. Es wird darauf ankommen, die Begeisterung mit einer Scheidung und Prüfung der Geister zu verbinden. Die Einladung, gemeinsam Kirche zu werden, und der Mut, für ein klares Profil zu kämpfen, gehen Hand in Hand. Weder darf einem entmündigenden, unpolitischen Christentum das Wort geredet werden, noch darf ein unverbindliches Christentum ohne Engagement, commitment, protegiert und schöngeredet werden.
Es wird viel dazu gehören, den Glauben vielleicht als Angelegenheit einer Minderheit zu begreifen und trotzdem bei den Überzeugungen und Inspirationen zu bleiben, die aus dem Glauben kommen. Also nicht Riesentempel als Machtdemonstration zu bauen und die Götzen zu predigen, die Erfolg und Wohlstand versprechen. Und wenn es denn Wenige sein sollten, dann muss die Stimme der Wenigen dabei nicht weniger kräftig und bedeutend sein, als die der Mehrheit. Man denke an die Mennoniten mit ihrer klaren pazifistischen Überzeugung und die italienische Waldenserkirche mit ihrer beeindruckenden Versöhnungsarbeit, kleine, aber keineswegs unbedeutende Kirchen mit einer klaren Position und - mit einer Migrationsgeschichte.
Uta Andrée
Uta Andrée
Dr. Uta Andrée ist Oberkirchenrätin der Evangelisch-Lutherischen in Norddeutschland.