Zu kurzatmig
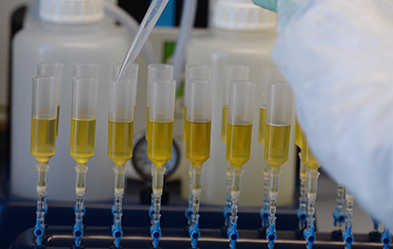
Zum Umgang mit vorgeburtlichem Leben herrscht in der Bundesrepublik Deutschland dauerhaft Meinungsstreit. Aktuell hat die Politik zu entscheiden, ob die gesetzlichen Krankenversicherungen für eine neue Methode der vorgeburtlichen Diagnostik die Kosten erstatten sollen. Es handelt sich um den nichtinvasiven Pränataltest, das heißt, um die Analyse von Blutproben, die Schwangeren schon vor der zwölften Schwangerschaftswoche entnommen werden können. Seit mehreren Jahren lässt sich mit Hilfe eines solchen Bluttests klären, ob beim vorgeburtlichen Kind bestimmte Chromosomenfehlverteilungen, insbesondere Trisomie 21, also das Down Syndrom vorliegen. Ein derartiges Risiko ist verstärkt dann vorhanden, sobald Schwangere über 35 Jahre oder erst recht wenn sie über 40 Jahre alt sind. Fällt der Test positiv aus, werden die Betroffenen in der Regel wohl die Konsequenz ziehen, die Schwangerschaft abzubrechen.
Prinzipiell wird das Risiko auf solche Krankheitsbilder schon seit Langem getestet. Die herkömmliche pränatale Diagnostik erfolgt aber erst im zweiten Drittel der Schwangerschaft, ungefähr von der 14. Schwangerschaftswoche an. Sie wird in Form eines invasiven Eingriffs durchgeführt. Meist wird der Schwangeren durch einen Einstich Fruchtwasser punktiert, wodurch sich feststellen lässt, ob beim Fetus eine Schädigung vorliegt.
Der invasive Eingriff belastet die Schwangere und kann darüber hinaus unter Umständen eine Fehlgeburt bewirken, so dass eventuell sogar ein gesunder Fetus abstirbt. Diese Schattenseiten der herkömmlichen pränatalen Diagnostik - die körperliche Belastung für die Schwangere sowie das Abortrisiko für das ungeborene Kind - lassen sich jetzt vermeiden, indem als Alternative zu dem invasiven Zugriff der schwangeren Frau einfach nur Blut abgenommen wird. Mittels der Blutprobe lässt sich dann schon recht früh in der Schwangerschaft äußerst treffsicher analysieren, ob das vorgeburtliche Kind insbesondere vom Down Syndrom betroffen ist. Bislang müssen sich Schwangere dieses treffsichere und schonende Verfahren finanziell „leisten“ können, weil sie es privat bezahlen müssen. Demgegenüber wird die herkömmliche pränatale Diagnostik, die belastend und gefahrenträchtiger ist, gegebenenfalls von den Krankenkassen abgedeckt. Folgerichtig sollte der Gesetzgeber jetzt dafür sorgen, dass Frauen, die dies wünschen, in medizinisch begründeten Fällen auch den neuen Pränataltest mittels einfacher Blutprobe ohne finanzielle Hürden nutzen können. Rechtsethisch ist hierzu an die Gebote der Fairness und der Zugangsgerechtigkeit sowie daran zu erinnern, dass alle Schwangeren gleichermaßen ein Recht auf Information besitzen.
Katholischer Rigorismus
Zu den gesellschaftlichen Gruppen, die zum pränatalen Test und zur Kassenfinanzierung strikt Nein sagen, zählt die römisch-katholische Kirche. Dies geschieht deshalb, weil sie Schwangerschaftsabbrüche generell rigoros ablehnt. Das Lehramt treibt seinen Rigorismus so weit, jede „vorsätzliche Abtreibung“ ganz ausdrücklich „Mord“ zu nennen. Der katholische Rigorismus beruht freilich auf dogmatischen Konstruktionen und auf naturrechtlichen Spekulationen, die rational unplausibel sind und die auch vielen Angehörigen der katholischen Kirche nicht einleuchten. Er kann keine gesamtgesellschaftliche, erst recht keinerlei rechtspolitische Geltung beanspruchen.
Im Jahr 2018 hat gleichfalls die EKD zu dem Thema Stellung bezogen. Unter dem Titel „Nichtinvasive Pränataldiagnostik“ veröffentlichte sie eine kleine Schrift, die einen „evangelischen Beitrag zur ethischen Urteilsbildung und zur politischen Gestaltung“ bieten soll.
Offenbar wollte die EKD vermeiden, einen kirchlich „hochrangigen“ Text zu präsentieren; sonst hätte sie ihre Publikation üblicherweise „Denkschrift“ oder „Orientierungshilfe“ genannt. Immerhin hat sie sich inhaltlich dann aber von dem römisch-katholischen Nein getrennt. Der Sache nach knüpft sie an ihre eigene ältere Linie an, zu der sie sich in den Siebzigerjahren aus Anlass der sozialliberalen Reform des Paragraph 218 Strafgesetzbuch mit seinen Erleichterungen des Schwangerschaftsabbruchs durchgerungen hatte. Seinerzeit akzeptierte sie das Grundrecht von Frauen auf Selbstbestimmung, auch was Entscheidungen über das vorgeburtliche Leben anbelangt. Ähnlich verhält es sich bei dem aktuellen Text. Er respektiert, dass Frauen in einen Schwangerschaftskonflikt geraten, wenn bei einem Fetus eine Krankheitsanlage festgestellt wird. Letztlich muss es ihrem eigenen persönlichen Urteil überlassen bleiben, ob sie die Schwangerschaft fortführen oder sie beenden.
Ohne es auszusprechen, hat die EKD auf diese Weise zugleich andere Äußerungen korrigiert, die sie in den vergangenen Jahren zur Biomedizin getätigt hat. Denn sie hat sich immer wieder der katholischen Position angenähert, die persönliche Selbstbestimmung der Menschen beiseitegeschoben und für staatliche Einschränkungen, gar für Verbote plädiert. Dies erfolgte etwa 2011 in ihrem Votum, das die staatliche Zulassung der Präimplantationsdiagnostik verhindern wollte, oder in ihrer „Orientierungshilfe“, in der sie sich mit der Beihilfe zum Suizid schwerkranker Patienten beschäftigte. In der Orientierungshilfe hatte sie Individualethik und Sozialethik gegen-einander ausgespielt und den Standpunkt vertreten, dass Handlungen, die „individualethisch“ nachvollziehbar seien, „sozialethisch“ abgelehnt werden müssten. Es ist sehr zu begrüßen, dass die EKD eine derartig inkonsistente Sicht jetzt hinter sich gelassen hat.
Trotzdem ist auch der neue Text argumentativ schwach ausgefallen. Die Schwäche resultiert bereits daraus, dass er das Ja, das er zum Selbstbestimmungsrecht Schwangerer ausspricht, nicht näher begründet. Bei der Lektüre fragt man sich, ob die EKD einfach nur die Garantie des Selbstbestimmungsrechts übernimmt, auf die der säkulare Staat verfassungs- und grundrechtlich verpflichtet ist, oder ob sie zusätzlich eigene protestantisch-theologische Gründe sieht. Sofern Letzteres der Fall sein sollte, hätte die EKD dies darlegen sollen. Doch wie immer es sich hiermit verhalten mag - künftig werden die Stellungnahmen der EKD daran zu bemessen sein, dass sie bei der jetzt wieder bekräftigten Linie bleiben, zu biomedizinischen Fragen die persönlichen Selbstbestimmungsrechte der Menschen zu achten. In Zukunft sollte die EKD nicht erneut in moralpaternalistische Denkmuster zurückfallen.
Leider enthält der Text auf der Hintergrund- und der Begründungsebene noch weitere Schwächen. Weil Pränataltests in der Konsequenz auf Schwangerschaftsabbrüche hinauslaufen, bricht ethisch und rechtlich die Grundsatzfrage auf, welcher Schutzstatus vorgeburtlichem Leben zuzuschreiben ist.
Die EKD geht hierauf nur formelhaft ein, etwa dadurch, dass sie an einer Stelle das ungeborene Kind ein „geliebtes Geschöpf des gnädigen Gottes“ nennt. Sie verzichtet völlig darauf, ein Argument zu diskutieren, das sich zugunsten des nichtinvasiven Pränataltests anführen lässt. Die herkömmliche pränatale Diagnostik findet erst in einer späteren Phase der Schwangerschaft statt. Demgegenüber bewirkt der neue Pränataltest, dass eine Schwangerschaft gegebenenfalls schon frühzeitiger abgebrochen werden kann. Zu diesem früheren Zeitpunkt sind Feten noch nicht so weit entwickelt wie bei späten Abbrüchen. Zum Beispiel sind sie noch nicht schmerzempfindlich. Ethisch sprechen triftige Argumente für einen graduellen Schutz vorgeburtlichen Lebens, so dass der Schutzanspruch zunimmt, je weiter ein Fetus entwickelt ist und seine organischen oder neuronalen Funktionen ausgebildet sind. Deswegen sind Schwangerschaftsabbrüche umso weniger bedenklich, je früher sie durchgeführt werden. Es wäre sinnvoll gewesen, wenn die EKD solche Gesichtspunkte erwähnt, entfaltet und zu ihnen Stellung genommen hätte, statt das Thema nur mit Schlagworten zu behandeln.
Ein anderes Problem, das sowohl durch die herkömmliche pränatale Diagnostik als auch durch den neuen vorgezogenen Bluttest aufgeworfen wird, erörtert die EKD ebenfalls nicht sehr tiefschürfend. Beide Verfahren wollen herausfinden, ob beim Fetus ganz bestimmte Krankheitsanlagen vorhanden sind. Bei positivem Befund erfolgt meist ein Schwangerschaftsabbruch. Kritische Stimmen wenden ein, dass auf diese Weise Menschen mit Behinderungen zumindest indirekt diskriminiert und dass gesellschaftliche Tendenzen verstärkt würden, die für Menschen mit Beeinträchtigungen ungünstig seien.
Nur Schlagworte
Solche Kritik ist ernst zu nehmen. Sie ist substanziierter aufzuarbeiten, als es in dem EKD-Beitrag geschieht. Zunächst ist zu betonen, dass sich Frauen, die sich wegen eines auffälligen Befunds gegen die Fortführung der Schwangerschaft entscheiden, in einer existenziellen Ausnahmesituation befinden. Ihr Entschluss richtet sich weder subjektiv-intentional noch objektiv gegen die Würde oder gegen die Rechte von Menschen, die behindert geboren worden sind oder die sich im Lauf ihres Lebens eine Behinderung zuziehen.
Vor allem ist zu unterstreichen, dass die Menschen, die in unserer Gesellschaft mit Behinderungen oder Einschränkungen leben, im konkreten Lebensalltag nicht diskriminiert werden dürfen, sondern aktiv zu unterstützen und in ihren Lebenschancen zu fördern sind. Hierauf zielen die UN-Behindertenrechtskonvention sowie neuere staatliche Gesetze ab. An dieser Stelle sollten evangelische Kirchen ihren eigenen Nachholbedarf aufarbeiten. So fällt es ihnen äußerst schwer, im Pfarrerdienstrecht Schutzstandards, die das staatliche Beamtenrecht für Menschen mit Behinderung vorschreibt, für ihren eigenen kirchlichen Bereich zu übernehmen. An solchen Sachverhalten ist anzusetzen, um den Schutz- und den Förderungsansprüchen von Menschen mit Behinderung glaubhaft gerecht zu werden und um den Sorgen und den Emotionen entgegenzuwirken, es seien ausgerechnet neue biomedizinische Methoden, die die Achtung vor Menschen mit Behinderungen untergraben würden.
Unpräziser Vorschlag
Zum Pränatal- beziehungsweise zum Bluttest selbst schreibt die EKD, neben der Selbstbestimmung von Schwangeren sei der Lebensschutz zu berücksichtigen. Um ihm Geltung zu verschaffen, fordert sie vom Staat, zum Pränataltest eine ethische Beratung einzuführen, die im Sozialgesetzbuch zu verankern sei. Die EKD trägt diesen Vorschlag sehr nachdrücklich vor. Offenbar macht er die Pointe dessen aus, was sie zu dem Thema sagen möchte.
Freilich zeigt sich hier wieder die argumentative Schwäche des EKD-Textes. Zweifellos sind psychosoziale oder ethische Beratungsgespräche, die unabhängig von den behandelnden Ärzten durchgeführt werden, für Patientinnen und Patienten angesichts komplexer medizinischer Entscheidungszwänge äußerst wichtig. Der Ausbau von Beratungsstellen ist für zahlreiche Sektoren des Gesundheitswesens das Gebot der Stunde. Strukturpolitisch ist dabei auf die weltanschauliche Pluralität der Beratungsstellen zu achten. Beraterinnen und Berater haben die Autonomie der Patienten zu respektieren und sind zur ergebnisoffenen Gesprächsführung verpflichtet. Nur: Ausgerechnet zur pränatalen Diagnostik und zu Schwangerschaftskonflikten sind behandlungsunabhängige psychosoziale Beratungsangebote bereits jetzt verfügbar und sogar gesetzlich vorgeschrieben.
Offenbar schwebt der EKD vor, die schon vorhandenen psychosozialen Beratungen mit Bezug auf den Pränataltest additiv um eine weitere, zusätzliche ethische Beratung zu ergänzen. Aber es wird nicht erläutert, wie beides sich zueinander verhalten soll und wie man sich realistisch eine Umsetzung vorstellen soll. Der Text, den die EKD von ihrer Kammer für öffentliche Verantwortung hat erarbeiten lassen, bleibt auch in dieser Hinsicht unpräzise und kurzatmig.
Hartmut Kreß


