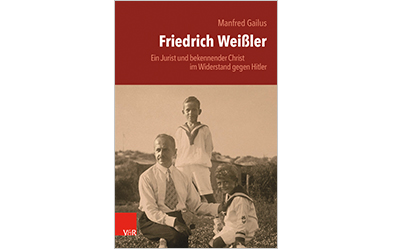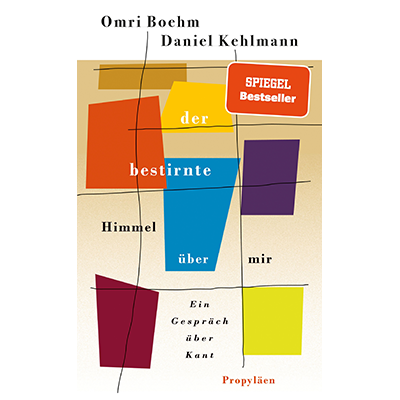Mit seiner Biographie über Friedrich Weißler (1891–1937) ist dem Kirchenhistoriker Manfred Gailus ein doppelter Wurf gelungen. Zum einen schildert er eindrücklich die Assimilation einer aus Osteuropa stammenden jüdischen Familie in das christliche deutsche Bürgertum. Zum anderen wirft er einen erschütternden Blick auf den Mord an einem Mitglied der Bekennenden Kirche, ohne dass dieser Mann einen besonderen Schutz durch die Kirchenleitung erfahren hätte.
Oft ist lapidar zu lesen, Juden in Deutschland hätten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend assimiliert. Gailus schildert das beginnend mit dem gezielten Umzug von Adolf Weißler von Oberschlesien nach Halle (Saale) im Jahr 1893. Selbst jüdisch ohne religiös zu sein, lässt er seinen ältesten Sohn ohne Einwilligung der Ehefrau taufen, die beiden anderen Söhne offenbar zumindest gegen den „Widerstand“ ihrer Mutter. Es folgt ein Aufstieg in das gehobene Bürgertum, arriviert, mit Ansehen und gewissem Wohlstand. Adolf Weißler liebt die deutsche Kultur. Die „Schmach von Versailles“ erträgt er nicht und nimmt sich 1919 das Leben.
Friedrich Weißler leugnet seine jüdische Herkunft nicht, versteht sich aber als Christ. Nur selten erfährt er Diskriminierung. Er studiert Jura wie der Vater, heiratet eine Pfarrerstochter und ist beruflich so erfolgreich, dass er im Oktober 1932 zum Landgerichtsdirektor in Magdeburg berufen wird. Was Gailus in den nächsten Kapiteln beschreibt, ist teilweise schwer zu ertragen. Innerhalb allerkürzester Zeit wird ein anerkannter Mann gedemütigt, als „nicht arischer“ Richter entlassen und seiner gesellschaftlichen Stellung beraubt. Weißler zieht mit seiner Frau und den beiden Söhnen nach Berlin und erhält eine Stelle bei der Bekennenden Kirche. Gailus schildert, wie er einerseits Ressentiments begegnet, die ihm aufgrund seiner jüdischen Abstammung entgegenschlagen, und andererseits in die Spannungen zwischen der Dahlemer Fraktion um Martin Niemöller und den Lutheranern um August Marahrens gerät. Weißler avanciert zum Bürochef der Kirchenleitung, während diese eine Denkschrift erarbeitet. 1936 erscheint die geheim gehaltene Denkschrift im New Yorker Herald Tribune. Da das NS-Regime in diesem Jahr besonders bemüht war, durch die Olympischen Spiele in Berlin internationale Anerkennung zu erhalten, wurde diese Veröffentlichung als massives Ärgernis empfunden. Friedrich Weißler wurde verhaftet und stand dazu, den Text weitergegeben zu haben. Schwer erträglich ist heute, nachzulesen, wie Wenige aus der Bekennenden Kirche sich hinter Weißler stellten, während er in Haft war. Seine Frau und seine Kinder blieben ohne klare Unterstützung. Am Ende wurde er ins Konzentrationslager Sachsenhausen überführt und als „Jude“ von SS-Männern innerhalb weniger Tage zu auf brutalste Weise zu Tode geprügelt. Hieß es zunächst, Weißler habe Selbstmord begangen, wurden die Täter am Ende überführt, die nichts von ihm wussten, aber meinten, einen „Juden“ erschlagen zu dürfen...
Das alles ist grauenvoller Teil der deutschen Schuldgeschichte. Aber es ist Manfred Gailus nicht nur zu danken, dass er den „ersten Märtyrer der Bekennenden Kirche“ mit seiner Geschichte in unser Gedächtnis holt. Er transportiert auch heftige Fragen. Warum etwa gab es keine Solidaritätskampagne mit Weißler nach seiner Verhaftung, warum setzte sich die Bekennende Kirche nicht für ihn ein? Auch Martin Niemöller, der später selbst verhaftet wurde und eine große Solidarität erlebte, erwähnte Weißler mit keinem Wort. Ist das Teil des fortwährenden Antijudaismus?
Gailus provoziert gewiss viele, wenn er im letzten Kapitel seiner Weißlerbiographie mahnt, im Reformationsjubiläumsjahr 2017 müsse auch die „Von-Luther-zu-Hitler-These“ mitbedacht werden und auch, dass das Verhalten der Bekennenden Kirche im Fall Weißler kein Ruhmesblatt war. Aber solche Provokation ist notwendig, soll doch das Gedenkjahr 2017 selbstkritisch die eigene Geschichte reflektieren und damit eine Lerngeschichte dokumentieren. Das Schicksal von Friedrich Weißler ist ein guter Anlass dazu und diese Biografie eine schon deshalb lesenswerte Lektüre.
Margot Käßmann