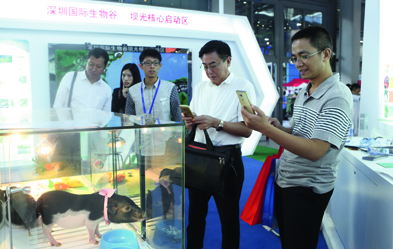
Auf den ersten Blick scheint es wie eine Endlosschleife zu sein: Jeder neue Fortschritt in der Biotechnologie wird mit den immer gleichen alten Bedenken umwölkt. Zu den regelmäßig aufgewärmten Topoi der Skepsis gehört Aldous Huxleys Schöne neue Welt genauso wie obskure „Designer-Babys“. Nachdem solche und weitere Schreckensbilder in den vergangenen Jahren zum Beispiel bei den Debatten um die Präimplantationsdiagnostik (PID) an die Wand gemalt wurden und trotz der bedingten Zulassung dieses biomedizinischen Verfahrens in Deutschland nicht Realität geworden sind, sieht sich nun das so genannte genome editing mit entsprechenden kritischen Anwürfen konfrontiert. Auch ohne die biochemischen Details im Einzelnen zu verstehen - es leuchtet sofort ein, warum dieses Verfahren die Fachwelt elektrisiert und die Öffentlichkeit irritiert. Kurz gesagt: Mit der so gennanten CRISPR/Cas-Methode steht ein Verfahren zur Verfügung, mit dem das Erbgut, die DNA, recht präzise an bestimmten Stellen geschnitten werden kann, um gezielt Sequenzen einzufügen, zu entfernen, auszutauschen, zu aktivieren oder zu deaktivieren. Zusammengefasst wird dies als genome editing oder auch gene editing bezeichnet.
Obwohl weder wissenschaftlich trivial noch ethisch vollkommen unbedenklich, ruft die Anwendung von CRISPR/Cas im Erbgut von Bakterien, Pflanzen und Tieren - erwartbar - nicht die Skepsis hervor, der die Forschung mit CRISPR /Cas an menschlicher, vor allem embryonaler DNA begegnet. Wo immer eine neuartige Biotechnologie Unsicherheiten generiert, wird der Ruf nach einem Forschungsmoratorium, einer Unterbrechung der weiteren Erforschung, einer Entschleunigung des Fortschrittes laut. Die gewonnene Zeit soll dann für die gesellschaftliche Verständigung darüber genutzt werden, welche Perspektiven eine Technologie in Zukunft überhaupt haben soll.
Entschleunigung des Fortschritts
In zeitzeichen 3/2017 hat Kai Gehring für das genome editing ein solches Moratorium gefordert, „um zu überlegen, ob und wie wir die Technologie nutzen wollen und welche Regeln möglichst für die ganze Menschheit gelten sollen.“ Auch wenn, wie unter anderem der „International Summit on Human Gene Editing“ im Dezember 2015 verlauten ließ, ein global einheitlicher Umgang mit dem genome editing wünschenswert erscheinen mag - nicht zuletzt auch, weil das menschliche Genom schließlich etwas alle Menschen Verbindendes sei dürfte eine weltweit geltende Regelung doch ein frommer Wunsch bleiben. Dazu haben bereits zu viele Nationen den Weg für weitergehende Forschungen mit CRISPR /Cas an und mit humaner DNA geebnet. Abgesehen von der wissenschaftspolitischen Großwetterlage ist es nicht zuletzt auch die weltweite Pluralität und Diversität normativer Grundhaltungen und Einstellungsmuster, die einen Konsens im Umgang mit einer gleicherweise vielversprechenden wie brisanten Biotechnologie nahezu verunmöglichen. Einzig das nahezu weltweit akzeptierte Verbot, Menschen zu reproduktiven Zwecken zu klonen, bildet hier eine Ausnahme - nicht zuletzt aber auch deshalb, weil der Nutzen dieser Technologie unklar ist.
Im Falle von Manipulationen an der menschlichen Keimbahn kommt noch ein weiterer limitierender Faktor hinzu. Die von 29 europäischen Staaten ratifizierte „Konvention von Oviedo“ hat hier bereits 1997 bindendes Recht auf internationaler Ebene geschaffen. Artikel 13 hält fest: „Eine Intervention, die auf die Veränderung des menschlichen Genoms gerichtet ist, darf nur zu präventiven, diagnostischen oder therapeutischen Zwecken und nur dann vorgenommen werden, wenn sie nicht darauf abzielt, eine Veränderung des Genoms von Nachkommen herbeizuführen.“ Zumindest einem Hauptkritikpunkt am genome editing im Humanbereich, nämlich die Herbeiführung von vererbbaren Veränderungen am Genom, ist damit wirkungsvoll begegnet. Insofern besteht zumindest für die Staaten, in denen das Abkommen gilt - die Bundesrepublik gehört allerdings nicht dazu - ein geringerer Bedarf und auch ein geringerer Druck, eine gesetzliche Regulierung von Keimbahninterventionen zu forcieren.
So oder so: Es wird bloß eine kleines „Wir“ bleiben, das den Zeitgewinn eines Moratoriums nutzen könnte, um über die weitere Anwendung des genome editing nachzudenken. Nun ist gerade Deutschland ja nie einem speziellen Weg abgeneigt gewesen, wenn es um die Regulierung biomedizinischer und biotechnologischer Verfahren ging. Im Falle des genome editing lassen sich aber gute Gründe anführen, die zumindest die Sinnhaftigkeit eines Moratoriums in Zweifel ziehen.
Negatives Ergebnis
Die Forschungen zum genome editing zunächst nicht weiter voranzutreiben, kann bei einer rasant voranschreitenden Technologie de facto einem Abschied gleichkommen. Da ein gesellschaftlicher Konsolidierungsprozess selbst auf nationaler Ebene schlicht Zeit in Anspruch nimmt, können mit einem Moratorium Fakten geschaffen werden, die zumindest ein negatives Ergebnis des Deliberationsverfahrens wahrscheinlicher werden lassen als ein positives. Denn selbst wenn am Ende die Entscheidung stünde, genome editing weiter zu nutzen: Zwischenzeitlich könnte die technologisch-wissenschaftliche Entwicklung so weit vorangeschritten sein, dass eine Anknüpfung an das aktuell erreichte wissenschaftliche Niveau weder personell noch technisch ohne weiteres möglich ist.
Es ist auch nicht viel gewonnen, wenn das Moratorium strikt auf Interventionen in die Zellen der menschlichen Keimbahn, also beispielsweise embryonale Zellen, beschränkt bleibt. Diese Fokussierung setzt irrtümlicherweise voraus, dass die 1883 von August Weismann eingeführte Unterscheidung von Keimbahnzellen - die Abfolge von Zellen, die von der befruchteten Eizelle an schließlich zur Ausbildung von Keimzellen im neuen Individuum führt - und somatischen Zellen, die nicht am Fortpflanzungsprozess oder der Entwicklung von Keimzellen beteiligt sind, immer noch strikt durchzuführen ist. Tatsächlich hat der wissenschaftliche Fortschritt hier neue Perspektiven eröffnet. Mit der Möglichkeit, somatische Zellen beispielsweise zu pluripotenten Stammzellen oder auch zu Gameten zu reprogrammieren, ist die strikte Differenzierung jedenfalls hinfällig. Bestimmte Zelltypen ins Visier zu nehmen, erscheint damit zunehmend nicht der beste Weg zu sein, um eine konsistente Regulierung zu erreichen. Wer verhindern will, dass manipuliertes Erbgut an nachfolgende Generationen weitergegeben wird, sollte auch genau das adressieren. Der Ansatz der Konvention von Oviedo, sich konkret an Verwendungszwecken zu orientieren - hier: reproduktionswirksame Manipulationen - könnte vor diesem Hintergrund durchaus wegweisenden Charakter haben.
Allerdings: Selten genug werden wirklich Gründe dafür benannt und offen diskutiert, warum bestimmte Veränderungen am menschlichen Genom nicht an nachfolgende Generationen weitervererbt werden sollen. Oftmals scheint die intuitive Plausibilität hinreichend zu sein. Und der Verweis auf eine Keimbahnmanipulation wirkt eher als Diskussionsstopper denn als die Eröffnung einer ernsthaften, gesellschaftlichen und politischen Debatte. Das kulturelle Unbehagen angesichts biotechnischer Optionen und ihrer Ziel- und Zweckperspektiven sollte durchaus ernst genommen werden. Es kann aber eine mit Argumenten zu führende Debatte nicht ersetzen und ist für sich genommen nicht hinreichend, um innerhalb eines demokratischen Gemeinwesens ein Moratorium zu legitimieren. Jedenfalls gilt dies, wenn die in Frage stehende Technologie dem Schutz hochrangiger Güter dienen könnte. Im Falle des genome editing ist zumindest die Idee, die genomischen Ursachen erblich bedingter Erkrankungen bereits im Embryonalstadium zu beseitigen, eine mögliche Anwendung, die nicht nur der Gesundheit dienen, sondern ihre volle Wirkung gerade dann entfalten würde, wenn auch zukünftige Generationen von diesem Eingriff profitieren würden. Vor diesem Hintergrund müssen zumindest Argumente, die gegen eine reproduktionswirksame Intervention sprechen, zur Diskussion gestellt werden - auch um am Ende ein mögliches Verbot wirklich zu legitimieren.
Unter den (Gruppen von) Gründen, die regelmäßig gegen reproduktionswirksame Manipulationen an der menschlichen Keimbahn angeführt werden, bilden drei eine Art argumentativen Kern. Erstens werden Interventionen in das Genom von Kritikern als Eingriff in die Natürlichkeit der Fortpflanzung klassifiziert - mit der Nahwirkung, dass Schwächen noch stärker disqualifiziert werden, Optimierungstendenzen zunehmen und die Vielfalt dessen, was als menschlich gilt, abnimmt - und der Fernwirkung so genannter Designer-Babys oder der Übertragung des Zuchtparadigmas auf den Menschen. Was natürlich ist, ist allerdings bei weitem nicht so selbstverständlich, wie das Argument vorgibt, wie überhaupt die unterstellte Unterscheidung von natürlich und künstlich selbst hochgradig artifiziell ist. Darüber wurde und wird eine breite ethische Debatte geführt, die, je länger sie andauert, desto deutlicher werden lässt, wie vernebelnd Verweise auf die Natürlichkeit tatsächlich sind.
Unbekannte Langzeitwirkung
Und selbst wenn die befürchteten Nah- und Fernwirkungen realistisch sein sollten, gibt es doch ausreichende gesellschaftliche und politische Steuerungsmechanismen, um ihnen entgegenzuwirken. Auch im Falle der PID ist es durch die entsprechende Gesetzgebung gelungen, die Anwendung dieses Verfahrens auf solche Fälle zu beschränken, in denen einem Kind mit höchster Wahrscheinlichkeit schwere Erbkrankheiten drohen. Ganz gleich, ob mit Dammbrüchen oder schleichenden Verschiebungen von Grenzen argumentiert wird: Für eine Gesellschaft sollte es wesentlich beunruhigender sein, wenn ihre gewählten politischen Vertreter meinen, bestimmten Entwicklungen nicht wirksam begegnen zu können.
Zweitens wird von Kritikern darauf verwiesen, dass nachfolgende Generationen nicht ihr Einverständnis dazu geben können, dass ihr Genom manipuliert wurde. Das ist richtig, und doch ist zugleich fraglich, inwieweit dies überhaupt von Bedeutung ist. Immerhin ist aus der Epigenetik mittlerweile hinreichend bekannt, dass eine ganze Reihe von Umwelt- und Verhaltensfaktoren die Genomaktivitäten in nachfolgenden Generationen beeinflussen - und sicher nicht immer zum Besseren. Dennoch scheint hier, auch mit Recht, kein besonderer Wille zu bestehen, beispielsweise gesundheitsschädliches Verhalten mit dem Argument zu verbieten, dass es in den nachfolgenden Generationen Auswirkungen auch auf das Genom (im weitesten Sinne) haben kann, denen die Nachkommen nicht zustimmen können. Aus welchen Gründen sollte das bei einem sehr gezielten Eingriff, der der Beseitigung eines realen Risikos für eine Erbkrankheit dient, anders sein?
Drittens wird vollkommen zutreffend darauf verwiesen, dass ein Verfahren wie das genome editing derzeit nicht sicher ist: Es ist noch so gut wie nichts über Langzeitwirkungen bekannt. Es ist auch unklar, ob die Genschere immer so präzise schneidet, wie sie soll, und ob die tatsächlichen Konsequenzen auch den erwarteten entsprechen. Dieses Argument ist meines Erachtens mit das stärkste. Allerdings taugt es kaum, um ein Moratorium zu begründen - im Gegenteil. So lange berechtigte Bedenken gegen die Sicherheit des Verfahrens bestehen, darf es nicht angewandt werden. Aber um diese Bedenken zu beseitigen, muss weitere Forschung zugelassen und eventuell sogar gefördert werden. Es hat jedenfalls den Anschein der Unaufrichtigkeit, dem genome editing richtigerweise mangelnde Sicherheit bei der klinischen Anwendung zu attestieren und gleichzeitig die Forschung zur Beseitigung dieser Unsicherheiten zu unterbinden.
Die ethischen und sozialen Aspekte des genome editing sind keineswegs trivial. Aber genau deshalb braucht es eine gut informierte und vor allem sachliche Debatte. Ein Forschungsmoratorium erscheint dazu weder notwendig noch sinnvoll. Was wir brauchen, wäre eine an realisitischen Gegebenheiten orientierte, mit Argumenten geführte, offene Diskussion über das genome editing, die das Ziel verfolgt, begleitend zur wissenschaftlich-technischen Entwicklung den gesellschaftlichen Korridor zwischen einem anything goes auf der einen und einem Totalverbot auf der anderen Seite auszuloten. Dabei mag sich ergeben - und das ist gar nicht unwahrscheinlich -, dass reproduktionswirksame Interventionen in die Keimbahn unterbleiben sollen. Wenn dafür plausible Gründe geliefert werden und damit nicht zugleich jedwede Forschung an menschlicher DNA unterbunden wird, ist das eine durchaus begrüßenswerte Lösung. Ein Moratorium braucht es dafür gerade nicht.
weiter zum Beitrag Kai Gehring
Jens Ried


