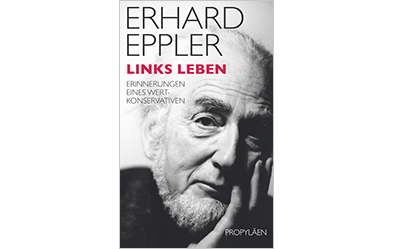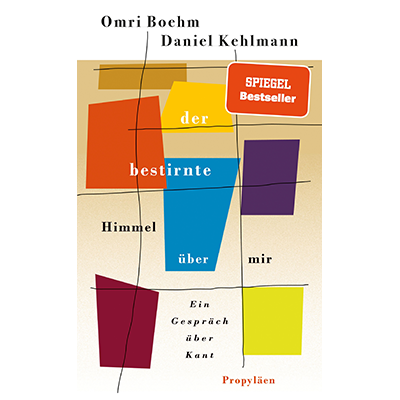Dieses Buch sollten auch diejenigen lesen, die – anders als der Rezensent – Erhard Eppler nicht mehr als aktiven Politiker und Kirchentagspräsidenten erlebt haben. Denn hier begegnet ein Politiker, wie man ihn heute schmerzlich vermisst, einer der nicht nur fachlich kompetent ist und das politische Handwerk versteht, sondern sich auch von Visionen leiten lässt.
Zum Vordenker konnte Eppler werden, weil er die Welt mit unverstelltem Blick betrachtete und sich seines Verstandes ohne Anleitung durch andere bediente. Als Entwicklungshilfeminister von 1968 bis 1974 sah er in der Dritten Welt, wie Menschen aus der Not heraus Raubbau mit der Natur trieben. Und das schärfte seinen Blick für die Naturzerstörung in unseren Breiten.
Eppler bekennt, dass er „noch 1968 keinen Zweifel“ an der Atomenergie hatte. Aber das änderte sich „ab 1975“. Er bezweifelte, dass Menschen „auf Dauer mit den Kräften des Atoms so umgehen könnten, dass Katastrophen vermeidlich wären“. Der Sozialdemokrat schreibt, er habe sich „immer darüber gewundert, wie lange und wie eifrig Konservative die Atomenergie verteidigt haben“, schließlich hätten doch gerade Konservative ursprünglich „dem optimistischen Menschenbild der Linken“ widersprochen. Eppler unterscheidet zwischen „Strukturkonservativen“ und „Wertkonservativen“. Erstere wollen Privilegien und zum Beispiel die autogerechte Stadt erhalten, letztere dagegen „Werte wie eine wunderschöne Landschaft“ und „die Solidarität zwischen Menschen“ bewahren. Dass Eppler nicht in die Klischees passte, die ihm Parteifreunde wie Gegner anhängten, zeigte sich auch, als er am 17. Juni 1989 vor dem Bundestag das Ende des sed-Regimes prophezeite. Diese Einsicht, die sich ein paar Monate später bewahrheiten sollte, hatte der Entspannungspolitiker bei Kirchentagen und Gesprächen mit Kirchenleuten in der DDR gewonnen.
Die Lektüre dieser Autobiographie lohnt auch, weil in ihr die jüngste deutsche Geschichte lebendig wird. Ihr Verfasser, 1926 geboren, wuchs in den NS-Staat hinein und wusste wie seine Freunde nicht, „was eine lebendige Demokratie ist“. Das hat Erhard Eppler in der Schweiz gelernt, weil er das Glück hatte, dass er 1947 für zwei Semester nach Bern eingeladen wurde. Bei einem der Gastgeber, dem renommierten altkatholischen Kirchenhistoriker Arnold Gilg, konnte er „lernen, was ein kluger, gebildeter Demokrat ist“. Und in der Evangelischen Studentengemeinde übte er „ganz praktisch Demokratie“ ein – wie man unterschiedliche Meinungen äußert und fair diskutiert. In Bern berührte ihn ein Vortrag Gustav Heinemanns, dessen politischer Weggefährte er später wurde. Und wichtig war für den Schwaben auch, dass er in Bern „keinem engen pietistischen Christentum“ begegnete, „sondern einem fröhlichen einladenden, neugierigen“. Er las das Neue Testament, von dem er gemeint hatte, er „kenne es schon“, und fand „einen jüdischen Wanderprediger, der einen väterlichen Gott“ predigt. Aber er ist froh, „dass die Europäer“ in Jesus auch „etwas Göttliches gesehen haben. Es hat ihnen gut getan, auch wenn sie dem, was sie lehrten, selten gewachsen waren“.
Man sieht, Eppler vertritt ein Christentum, das man liberal nennen kann. Jedenfalls ist er kein „Pietcong“, ein Klischee, das wohl auf Herbert Wehner zurückgeht und das der Spiegel und andere Medien befördert haben, weil sie in ihrer Voreingenommenheit schwäbisch-evangelisch mit pietistisch gleichsetzten.
Eppler wollte „die Ökologie“ in der SPD „heimisch machen und damit die Gründung einer grünen Partei verhindern“. Ersteres ist ihm schließlich gelungen. Dass ein Grüner schaffte, was Eppler 1976 misslungen war, einen CDU-Ministerpräsidenten in Stuttgart abzulösen, gehört zur Ironie der Geschichte. Oder zur Tragik. Denn die Reaktorkatastrophe von Fukushima bewirkte mehr als kluge Argumente. Eine Befürworterin der Atomenergie, Angela Merkel, setzte um, was Eppler fast 40 Jahre vorher gefordert hatte. Vielleicht reagiert seine Partei ja etwas schneller auf den Rat, nicht einfach auf „Wirtschaftskompetenz“ zu setzen, sondern auf das „Leitbild einer Gesellschaft, die gerechter, solidarischer und freier als bisher“ ist. Und der Philologe Eppler empfiehlt eine Sprache, „die an Werte erinnert, ohne pastoral zu klingen“, wie einst bei Willy Brandt.
Erhard Eppler: Links leben. Propyläen-Verlag, Berlin 2015, 336 Seiten, Euro 22,–.
Jürgen Wandel