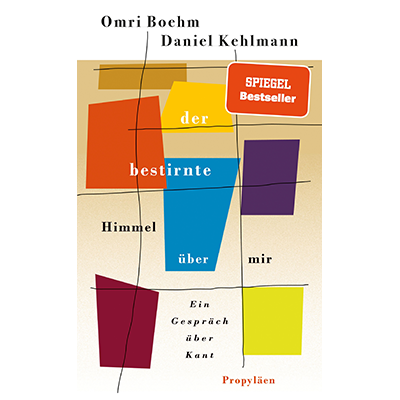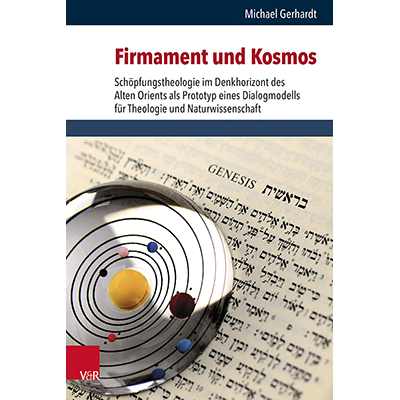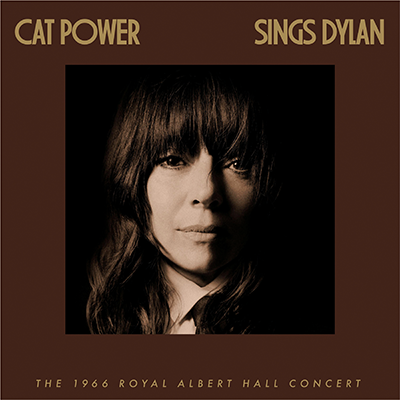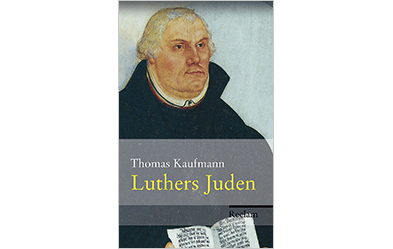
Im Vorfeld des Reformationsjubiläums 2017 ist Luthers Verhältnis zum Judentum in Kirche und Öffentlichkeit umstritten. Der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann hat seine wegweisenden Forschungen zu diesem Thema nun in einer gut lesbaren Überblicksdarstellung zusammengefasst. Sein Ziel ist die Versachlichung der Debatte durch die "Historisierung" Luthers. "Historisierung" heißt nicht, Luthers Judenfeindschaft zu relativieren oder gar zu entschuldigen. Vielmehr geht es darum, die historische Beschäftigung mit Luthers Verhältnis zum Judentum zu nutzen, um sich kritisch mit seiner Judenfeindschaft auseinanderzusetzen.
Was "Historisierung" heißt, zeigt schon der Titel Luthers Juden: Weil Luther kaum Juden kannte und in einer Welt lebte, aus der jüdisches Leben weitgehend verschwunden war, war das Thema seiner Äußerungen über Juden eine aus oftmals zweifelhaften Quellen schöpfende Konstruktion der "Juden". Dieser Konstruktion geht Kaufmann nach, indem er wichtige Äußerungen Luthers vorstellt. Dabei zeigt sich zum einen die Kontinuität der judenfeindlichen Grundeinstellung: Luther habe stets am Absolutheitsanspruch des Christusglaubens festgehalten; das sich diesem Christusglauben verweigernde Judentum sei für ihn theologisch immer im Unrecht geblieben. Zum anderen zeigt sich eine Diskontinuität in den Empfehlungen für den Umgang mit den Juden. Luther wagte es nämlich 1523 - im Überschwang der frühen reformatorischen Bewegung -, die Diskriminierung der Juden infrage zu stellen und einen revolutionären Vorschlag zu machen: "Will man yhn helffen, so mus man [...] Christlicher liebe gesetz an yhn uben und sie freuntlich annehmen, mit lassen [er]werben und erbeytten, da mit sie ursach und raum gewynnen, bey und umb uns tzu seyn, unser Christlich lere und leben tzu horen und sehen" (WA 11, 336).
Für Kaufmann markiert dieser Vorschlag keinen grundsätzlichen Wandel in Luthers Einstellung, sondern nur einen Wechsel der Missionsstrategie. Nachdem aber Luthers Hoffnungen auf die Bekehrung der Juden durch die reformatorische Verkündigung allmählich zerstoben seien, habe er dann aber wieder die Forderung der Diskriminierung, ja der Unterdrückung und Vertreibung der Juden verfochten, - und er habe diese Forderung durch immer schärfere theologische Polemiken unterbaut, bis hin zu seinen "bösen Schriften" von 1543. Kaufmann zeichnet diese Kontinuitäts- und Diskontinuitätslinien in Luthers Verhältnis zum Judentum nicht nur anhand von Luthers Schriften nach, sondern bettet Luther auch in seine geschichtlichen Kontexte ein: Luthers Judenfeindschaft sei eng mit dem zeitgenössischen Diskurs über das Judentum verflochten und durchaus typisch für das Reformationsjahrhundert gewesen. Sie habe auch eine lange Wirkungsgeschichte bis ins 20. Jahrhundert gehabt. Kaufmann betont hinsichtlich der Rezeption von Luthers "Judenschriften" die Kontinuität: Abgesehen von vereinzelten Ausnahmen wie dem Pietismus habe in der Wahrnehmung des Reformators durch den Protestantismus die - vielfach bejahte - Judenfeindschaft Luthers dominiert. Anzumerken bleibt, dass die von Kaufmann vertretene Sicht von Luthers Judenfeindschaft und ihrer Rezeptionsgeschichte in der Forschung kontrovers diskutiert wird. Gleichwohl ist Kaufmanns Überblicksdarstellung eine der wichtigsten Veröffentlichungen zum Thema: Sie trägt dazu bei, die nicht selten hilflose und unfruchtbare Diskussion über das Thema "Luther und die Juden" durch Historisierung zu versachlichen.
Thomas Kaufmann: Luthers Juden. Reclam Verlag, Stuttgart 2014, 203 Seiten, Euro 22,95.
Andreas Stegmann