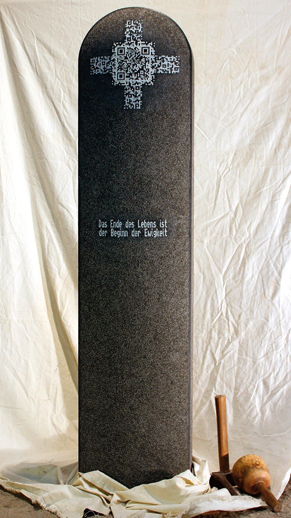

Streit um das Gipfelkreuz Bayern ist beliebt, auch bei zahlungskräftigen Touristen aus dem arabischen Ausland. Die Zahl der Besucher aus den Golfstaaten hat sich seit 2002 vervierfacht. Und so entschieden sich Tourismusexperten aus Garmisch-Patenkirchen, in einem arabischsprachigen Prospekt für die Zugspitzbahn den höchsten Berg Deutschlands so zu fotografieren, dass das Gipfelkreuz nicht zu sehen ist. Schließlich wollten die Touristen aus den heißen Ländern vor allem den Schnee sehen, hieß es. Doch die Rücksichtnahme auf religiöse Gefühle der erhofften Gäste sorgte für Ärger bei den einheimischen Kirchen. Der katholische Münchener Weihbischof Wolfgang Bischof bezeichnete die Bildauswahl als "unnötig und irreführend". Gipfelkreuze gehörten ganz selbstverständlich zu den bayerischen Bergen. "Sie zeigen die christliche Prägung unserer Gesellschaft und damit auch unserer Kulturlandschaft", so Bischof. Auch die evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler kritisierte die Fotoauswahl. Christen würden von Muslimen nur ernst genommen, wenn sie sich zu ihren Wurzeln bekennen und für ihren Glauben gerade stehen: "Mit Feigheit gewinnt man keinen Respekt", so die Regionalbischöfin in einem Kommentar für idea.

Von Tartüffeln und Kartoffelpredigern Kartoffelprediger hießen sie im 18. Jahrhundert. Wissenschaftlich interessierte Pfarrer experimentierten mit dem Kartoffelanbau und propagierten das neue Gewächs von der Kanzel. Auch eine Kanzel als Ausstellungsexponat im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte in Potsdam erzählt von der Geschichte der Kartoffel in Preußen. Unter dem Titel "König und Kartoffel" gehen die Ausstellungsmacherinnen der Kulturgeschichte der Kartoffel in Preußen auf den Grund. Sie räumen auf mit dem Gerücht, Friedrich II. habe die Kartoffel eingeführt. Er trug lediglich mit seinen Anordnungen wie den zum Beispiel original ausgestellten Kartoffelbefehlen zu ihrer Verbreitung bei. Gegessen hat sie der König nicht. Kulturgeschichtliches rund um die Kartoffel, Legenden und Mythen um Friedrich II, Interessantes zur Wirtschafts- und Agrargeschichte, aber auch über den Wandel der Ernährung erfährt der Besucher in der Schau sowie in einem umfangreichen und schön gestalteten Katalog. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Oktober geöffnet.


