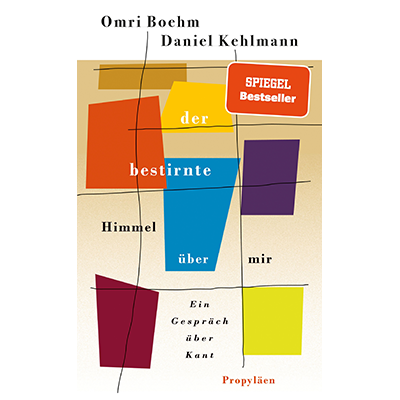Skepsis statt Optimismus

Was manche Vertreter der angeblichen neuen Leitwissenschaft als gern gesehene Gastredner präsentierten, galt vielen als Generalangriff auf das christliche und humanistische Menschenbild. Nicht zuletzt sollte die alte Frage nach dem freien Willen ein für alle Mal negativ beantwortet werden. Es gäbe schlicht keinen Raum für bewusste, freie Entscheidungen, hieß es. Neuronale Aktivitäten, Transmitterströme und bestimmte Verschaltungen im Gehirn hätten schon Voraussetzungen für Handlungen geschaffen, wenn wir noch glaubten, uns zu ihnen zu entschließen. Und, man meinte im Hirn einen God spot, einen neuronalen Gottesflecken, zu finden, der auf die Evolution zurückzuführen sei.
Die Reaktionen der Philosophen sind nach wie vor geteilt. Naturalistische Denker wie Daniel Dennett sehen ihre Hoffnung bestätigt, das Leib-Seele-Problem zu lösen, indem man Psychisches direkt auf physische Ursachen zurückführt. Andere sind skeptischer und betonen, menschliche Handlungen würden nach vernünftigen Gründen getroffen und seien danach zu beurteilen. Der Begriff einer materiellen Ursache reiche dazu nicht aus. Und frei könne man eine Handlung auch dann nennen, wenn sie in Übereinstimmung mit persönlichen Grundüberzeugungen getroffen werde, die auf Prägungen zurückgehen könnten. Sie müssten also nicht selbst frei erworben sein, um Freiheit zu ermöglichen.
Materielle Entsprechungen
Jedenfalls müssen neuronale Aktivitäten bis auf weiteres als materielle Entsprechungen subjektiver Erlebnisse gelten, aber nicht als deren Ursache. Das Gehirn ist wohl weniger eine Welt im Kopf, sondern ein "Beziehungsorgan", wie der Psychiater Thomas Fuchs formuliert. Es gibt nicht unser Verhältnis zur Um- und Mitwelt vor, sondern wird durch soziale Beziehungen geprägt und geformt.
In den Kern der Auseinandersetzung führt erneut der jetzt auf Deutsch erschienene Band "Neurowissenschaft und Philosophie", der Maxwell Bennett, Daniel Dennett, Peter Hacker und John Searle als prominente Autoren aufführt. Er bietet eine Auswahl des von Bennett und Hacker verfassten Buchs "Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften", das kürzlich von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt publiziert wurde, außerdem die philosophischen Entgegnungen von Dennett und Searle, die Replik auf diese Erwiderungen sowie eine Schlussbetrachtung des Philosophen Daniel Robinson.
Im Zentrum der Argumentation Bennetts, der Neurowissenschaftler ist, und Hackers, steht der Vorwurf, viele Neurobiologen begingen einen "mereologischen Fehlschluss", womit die Autoren an Aristoteles und Ludwig Wittgenstein anknüpfen. Diese Philosophen sagten nämlich von Bestandteilen eines Lebewesens aus, was logisch nur auf das ganze Lebewesen zutreffen könne. Deshalb sei es verfehlt zu formulieren, das Gehirn denke, empfinde etwas oder treffe eine Entscheidung. Das sei sinnvoll nur von der ganzen Person zu sagen, meinen Bennett und Hacker.
Ihre sprachanalytisch geschulte Kritik beziehen sie auf einige Details der Philosophie des Geistes. So versuchen sie den zur Charakterisierung von Bewusstseinsakten geprägten Begriff der Qualia (subjektives Empfinden) als untauglich auszuweisen. Schließlich wenden sie gegen die Neurowissenschaft den von materialistisch gestimmten Denkern erhobenen Vorwurf, ihre Kritiker hielten naiv am cartesianischen Dualismus von Leib und Seele fest, die demnach zwei getrennte Substanzen darstellten. Viele Zunftvertreter, so Bennett und Hacker, blieben auf eigentümliche Weise selbst einer solchen Zwei-Reiche-Lehre verhaftet: "Denn obschon sie die immaterielle Substanz des cartesianischen Geistes ablehnen, übertragen sie die Eigenschaften des cartesianischen Geistes auf das menschliche Gehirn, womit sie die ganze verfehlte Struktur der cartesianische Auffassung des Verhältnisses zwischen Geist und Körper unangetastet lassen."
Intellektueller Schlagabtausch
Als Leser gewinnt man leicht den Eindruck, die sprachkritische Sicht der Dinge werde hier etwas einseitig bevorzugt. Eine wissenschaftliche Beobachtung oder These ist ja nicht allein deshalb als unzutreffend oder abseitig zu kennzeichnen, weil sie in einem fehlerhaften oder missverständlichen Vokabular vorgetragen wird. Die von Bennett und Hacker kritisierten Philosophen Dennett und Searle bestärken in ihren Repliken jenen Eindruck und liefern Argumente, warum sie an ihrer Sicht der Dinge festhalten: Dennett verteidigt den Materialismus und die Neurowissenschaften, Searle auch den Begriff der Qualia.
Der intellektuelle Schlagabtausch auf hohem Niveau belegt: Es geht hier nicht so sehr um Verständigung als um klare Unterscheidung. Und was von der eigenen Sicht der Dinge abweicht, wird gehöriger Kritik unterzogen. Deshalb kann der Leser leicht auf den Gedanken kommen, es sei vor allem eine Glaubenssache, was vom jeweiligen Standpunkt und dessen Prämissen zu halten sei.
Wenn wir uns selbst erfahren und auf uns selbst beziehen, wie es in jedem bewussten Verhältnis zur Welt geschieht, sind wir immer beides zugleich, Seele und Leib. Für den cartesianischen Dualismus, der beides strikt trennt, gibt die Selbsterfahrung keine Argumente an die Hand. Der lebendige Mensch liefert den leibhaftigen Gegenbeweis und den Beleg dafür, wie Leib und Seele zusammengehen. Menschen mit starkem Kreativitätsüberschuss, Schachweltmeister oder Nobelpreisträger, belegen nicht das Gegenteil, sondern stehen eher für ein ausdifferenziertes Verhältnis von Geistigem und Körperlichem mit jeweiligen Ausschlägen nach oben und unten.
Somatik, nicht Semantik
Dennoch ist die Versuchung offenbar groß, Mentales auf materielle Ursachen zu reduzieren und es zum Verschwinden zu bringen, indem es lediglich als Funktion des Körpers begriffen wird. Die Realität psychischer Prozesse und Befindlichkeiten steht aber außer Frage, ebenso der Umstand, dass diese sich durch mentale Einwirkungen, wie in der Psychotherapie, verändern können. Allein materialistisch argumentierend kommt man Kunst, Musik und Poesie nicht auf die Spur. Sie nehmen deutend und interpretierend das Leben in den Blick, wie es die naturwissenschaftliche Perspektive nur unzureichend erfassen kann. Diese geht aufs Somatische, nicht auf Semantik, nicht auf die Sphäre des Sinns.
Auch der auf weitere Forschritte der Neurowissenschaft vertrauende John Searle hofft zwar, das Leib-Seele-Problem werde sich durch sie lösen lassen. Zugleich ist er aber überzeugt, dass sich die Fragen nach dem richtigen Leben und der besten sozialen Ordnung einer naturwissenschaftlichen Behandlung entziehen. In diesem Zusammenhang lässt sich auch auf das auf Aristoteles zurückgehende Konzept der Emergenz verweisen, wonach komplexe Systeme nicht vollständig aus ihren einzelnen Bestandteilen heraus verstanden und erklärt werden können. Paradoxien wie die Schrödingers von der Katze, die zur selben Zeit tot und doch lebendig ist, belegen die Schwierigkeiten, die Welt quantenphysikalisch zu erklären.
Jahrheitsskepsis bewährt sich leichter als Erkenntnisoptimismus. Prägend für unsere Sicht der Dinge, besonders individuelle, sind nicht zuletzt unbewusste psychische Vorgänge und die Kulturgemeinschaft, der man angehört, worunter auch eine bestimmte Sprache zu fassen wäre - wenngleich Searle und Dennett im angezeigten Band gegen eine solche Sicht der Dinge argumentieren.
Der Philosoph Richard Rorty, der die gängige philosophische Erkenntnistheorie einer grundsätzlichen Kritik unterzog, sah uns deshalb verstrickt in ein Netz kontingenter Beziehungen, aus dem es kein Entrinnen gibt. Rorty konnte dieser misslichen Lage freilich auch Vorteile abgewinnen. Wer Letztbegründungen nämlich ablehnt, tut sich leichter mit dem Gebot zur Toleranz gegenüber Andersdenkenden, wovon eine liberale Gesellschaft jedenfalls profitieren dürfte - und praktiziert ansonsten ein ironisches Weltverhältnis. Das könnte auch Konsequenzen haben für die andauernde Auseinandersetzung über Möglichkeiten und Grenzen der Neurobiologie, die mit mehr Gelassenheit und Aufgeschlossenheit für den jeweils gegenteiligen Standpunkt zu führen wäre.
Netz kontingenter Beziehungen
Derweil erweist sich auch die Theologie als anpassungsfähige Wissenschaft. Der Marburger Systematiker Hans-Martin Barth hat in der Neuen Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie (4/2009) vorgeschlagen, den God Spot, falls existent und auffindbar, zu "verstehen als ein Geschenk des Schöpfers, das in der Gestalt und Botschaft Jesu sich in seiner Funktion verdeutlicht und im Wirken des Heiligen Geistes sich in die selektionsgeprägte Wirklichkeit umsetzt". In biologischer Perspektive könnte diese physiologische Voraussetzung für die Entstehung der Religion als Schutzmechanismus verstanden werden. Er macht laut Barth dann klar, dass Versöhnung und Frieden "unabdingbar geboten sind, wenn die Welt biologischer und kultureller Evolution sich nicht erheblich beschädigen oder gar zerstören will".
Worauf am Ende alles hinausläuft, ob Liebe und Versöhnung das letzte Wort behalten werden, wie Gläubige meinen, oder nicht, ist eine Sache der Eschatologie - und schlicht abzuwarten. Sicher ist dagegen zunächst dies: Auf lange Sicht gesehen, werden wir alle tot sein, wie der britische Ökonom John Maynard Keynes die Frage nach einer längerfristig zuverlässigen Prognose lakonisch beantwortete. Das gilt bestimmt, ob mit oder ohne neurobiologischen Ratschlag. Und ebenso sicher darf man sein: Auch diese Wissenschaft kann nicht zuverlässiger als die bisherige sagen, ob es dabei ein für allemal bleibt.
NEUERE LITERATUR ZUM THEMA
Maxwell Bennett, Daniel Dennett, Peter Hacker, John Searle: "Neurowissenschaft und Philosophie". Aus dem Englischen von Joachim Schulte. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010, 277 Seiten, 29,80 Euro.
Thomas Groß
Thomas Groß
Thomas Groß ist Kulturredakteur des Mannheimer Morgen.